Du näherst dich der Bibel durch ein Kunstwerk. Beachte bitte dabei, dass die meisten älteren Kunstwerke, Jesus und die weiteren Akteure der Bibel nicht historisch gemalt haben. Jesus war nie weiß. Die Personen wurden in den westlichen Kontext hineingemalt. Dieser Hintergrund ist mir wichtig. Dennoch können uns die Bilder etwas über den Bibeltext sagen, wenn wir uns näher mit ihnen beschäftigen.
Eine Bildbetrachtung beginnt mit einem ersten Eindruck: Schau dir das Bild ruhig an und achte auf das, was dir sofort ins Auge fällt – Farben, Formen und Personen. Je nach Intensivität kannst du das Bild weiter analysieren. Schließlich folgen die Interpretation und persönliche Auseinandersetzung: Welche Botschaft könnte der Künstler vermitteln wollen? Welche Gedanken oder Gefühle weckt das Bild in dir? Welche Bedeutung nimmst du aus dem Bild mit?
Eine Anleitung zur Bildbetrachtung in einfachen Schritten:
Schritt 1: Erster Eindruck und allgemeine Beobachtungen
- Schau dir das Bild genau an: Nimm dir ein paar Minuten Zeit, um das Bild ganz ruhig anzusehen.
- Was fällt dir sofort auf? Welche Farben, Formen oder Personen siehst du?
- Was fühlst du? Bist du traurig, froh, überrascht oder vielleicht nachdenklich?
- Notiere deinen ersten Eindruck. Wenn du magst: Schreibe auf, was du als erstes denkst, wenn du das Bild siehst.
Schritt 2: Formale Analyse
- Wie ist das Bild aufgebaut? Achte darauf, wie die Figuren oder Objekte angeordnet sind. Gibt es eine wichtige Person oder ein Hauptthema?
- Welche Farben siehst du? Sind sie sehr leuchtend oder eher ruhig und gedämpft? Manchmal zeigen Farben eine bestimmte Stimmung (z. B. Rot kann für Leidenschaft oder Gefahr stehen).
- Licht und Schatten: Wo gibt es Licht? Wo ist es dunkel? Licht kann etwas besonders Wichtiges hervorheben, z. B. eine Person oder ein Symbol.
- Perspektive und Technik: Wie sieht das Bild aus? Welche Perspektive wurde gewählt? Worauf wird unser Blick gelenkt?
Schritt 3: Inhaltliche Analyse
- Lies dir in diesem Schritt 3 unbedingt die passende Bibelstelle aufmerksam durch.
- Was zeigt das Bild? Gibt es eine biblische Geschichte oder eine wichtige Szene? (Zum Beispiel, das letzte Abendmahl oder die Kreuzigung).
- Wer ist auf dem Bild? Wer sind die Personen? Was machen sie? Achte auf ihre Gesichtsausdrücke und Körperhaltungen – was vermitteln sie?
- Gibt es Symbole? Manchmal gibt es Gegenstände oder Zeichen, die eine tiefere Bedeutung haben, z. B. könnte eine Taube den Heiligen Geist symbolisieren. Oder Details, die uns kaum auffallen werden, wie z. B. die weibliche und männliche Hand von dem Vater beim Kunstwerk vom „verlorenen Sohn“ von Rembrandt.
- Gibt es Bewegung? Schau, ob du eine Art von Bewegung siehst – z. B., wie jemand läuft oder etwas macht.
Schritt 4: Interpretation und persönliche Auseinandersetzung
- Welche Gedanken oder Gefühle sollen damit geweckt werden? Welche Botschaft könnte der Künstler vermitteln wollen?
- Was spricht dich persönlich an? Welche Botschaft nimmst du aus dem Bild mit? Was fühlst du, wenn du das Bild siehst?
Hier ein paar Bildempfehlungen von bekannten Künstlern:
- “Der verlorene Sohn” – Rembrandt van Rijn
- “Das letzte Abendmahl” – Leonardo da Vinci
- “Die Erschaffung Adams” – Michelangelo
- “Die Kreuzabnahme” – Peter Paul Rubens
- “Der Sturm auf dem See Genezareth” – Rembrandt van Rijn
- “Die Geburt Christi” – Louise-Élisabeth Vigée-Le Brun
- “Die Huldigung der Hirten” – Gerard van Honthorst
- “Mose schlägt auf den Felsen” – Nicolas Poussin
- “Das Urteil des Pilatus” – Antonio Ciseri
- “Der Gang nach Emmaus” – Caravaggio
- “Die Verklärung Christi” – Raphael
- “Das letzte Abendmahl” – Salvador Dalí
- “Die Taufe Christi” – Verrocchio und Leonardo da Vinci
- “Die Auferstehung Christi” – Raffaello Sanzio da Urbino
- “Die Kreuzigung Christi” – Marc Chagall
- “Die Bergpredigt” – James Tissot
- “Die Heilung eines Blinden” – William Blake
Hier findest du Material von YOU/C zum Song “Das wahre Leben”.
Wenn du mehr zu YOU/C wissen willst, kannst du ganz unten auf der Seite nachschauen.
Das Playback (Instrumental) und die zwei- bis dreistimmigen Chornoten zu dem Song kannst du per E-Mail anfragen: you-c@ejwue.de
Hier siehst du das Musikvideo zu dem Song.
Weiteres Songmaterial findest du unter dem Video.
Audiospur Sopran
Audiospur Alt
Audiospur tiefe Stimme
YOU/C, die Sing-Community, will Jugendliche deutschlandweit für das (gemeinsame) Singen begeistern und miteinander vernetzen. Bestehende Teenie- und Jugendchöre möchte YOU/C unterstützen und auch dabei helfen, dass neue Gruppen entstehen, die zusammen singen. Dafür kommt das Team von YOU/C in Gemeinden und Bezirke und veranstaltet mit den Leuten vor Ort YOU/C-Days. Außerdem wurden mehrmals im Jahr moderne Songs mit zugehörigem Songmaterial über www.you-c.online veröffentlicht. Zu jedem Song gibt es ein zwei- bis dreistimmiges Chorarrangement, Tutorials und innovative Zusatzmaterialien, mit denen Interesse geweckt, Spaß vermittelt, Gottes Liebe spürbar gemacht und beim Singen und Üben der Songs unterstützt werden soll.
YOU/C ist Teil von „musikplus“ im Evangelischen Jugendwerk Württemberg (EJW) und kooperiert mit der Stiftung Creative Kirche in Witten.
Hier findest du Material von YOU/C zum Song “Magnificat”.
Wenn du mehr zu YOU/C wissen willst, kannst du ganz unten auf der Seite nachschauen.
Das Playback (Instrumental), die zwei- bis dreistimmigen Chornoten und die Multitracks zu dem Song kannst du per E-Mail anfragen: you-c@ejwue.de
Audiospur Sopran
Audiospur Alt
Audiospur tiefe Stimme
YOU/C, die Sing-Community, will Jugendliche deutschlandweit für das (gemeinsame) Singen begeistern und miteinander vernetzen. Bestehende Teenie- und Jugendchöre möchte YOU/C unterstützen und auch dabei helfen, dass neue Gruppen entstehen, die zusammen singen. Dafür kommt das Team von YOU/C in Gemeinden und Bezirke und veranstaltet mit den Leuten vor Ort YOU/C-Days. Außerdem wurden mehrmals im Jahr moderne Songs mit zugehörigem Songmaterial über www.you-c.online veröffentlicht. Zu jedem Song gibt es ein zwei- bis dreistimmiges Chorarrangement, Tutorials und innovative Zusatzmaterialien, mit denen Interesse geweckt, Spaß vermittelt, Gottes Liebe spürbar gemacht und beim Singen und Üben der Songs unterstützt werden soll.
YOU/C ist Teil von „musikplus“ im Evangelischen Jugendwerk Württemberg (EJW) und kooperiert mit der Stiftung Creative Kirche in Witten.
Mut-Gebet
“Ich bin mutig” darf laut gerufen werden.
Ich bin mutig!
Gott macht mich groß.
(nach oben strecken)
Ich bin mutig!
Ich bin nicht allein.
(bei einer anderen Person einklatschen)
Ich bin mutig!
Jesus geht voran.
(nach vorne springen)
Ich bin mutig!
Selbst wenn ich falle,
hält Gott mich.
(Arme überkreuzt auf die eigenen Schultern legen)
Amen.
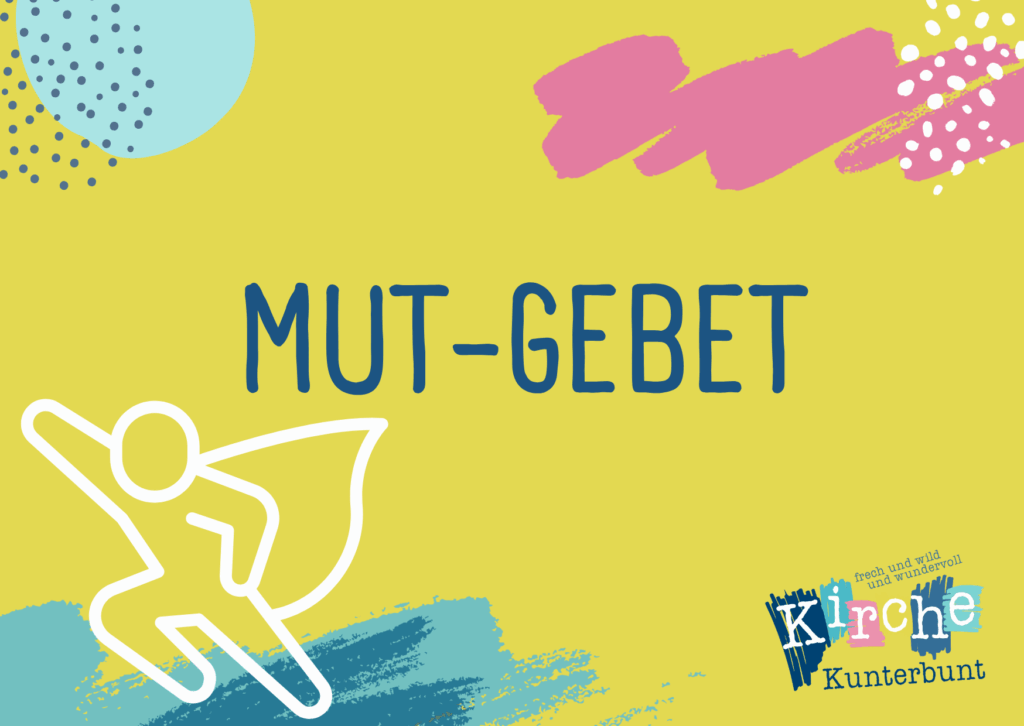
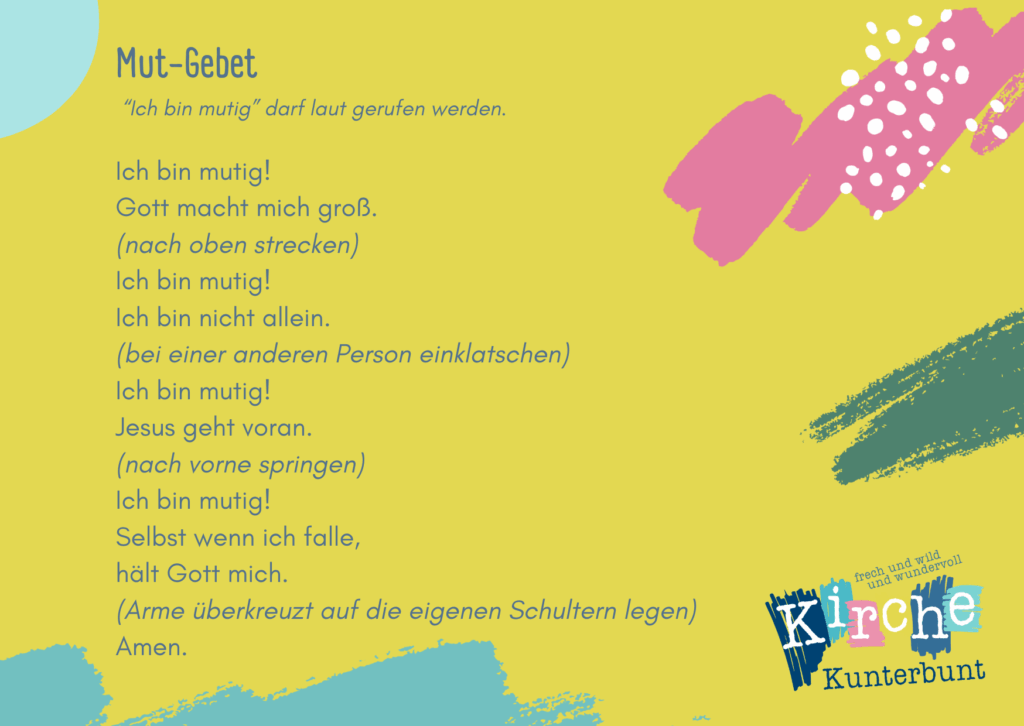
Ein Moodboard ist ein visuelles Gestaltungsmittel, das Stimmungen, Ideen, Emotionen oder Themen auf einen Blick erfassbar macht. Es wird häufig in der Design-, Mode- oder Werbebranche verwendet, lässt sich aber auch für einen kreativen Prozess mit biblischen Texten nutzen.
Was ist ein Moodboard?
Ein Moodboard (auf Deutsch: „Stimmungstafel“) ist eine Sammlung aus Bildern, Farben, Texten, Materialien und Symbolen, die zusammen eine bestimmte Atmosphäre oder ein Thema visualisieren. Es dient z.B. in der Werbung der Inspiration und Orientierung für ein kreatives Projekt.
Unterschiede Moodboard vs. Collage:
| Moodboard | Collage |
| Konzeptuell, thematisch orientiert | Künstlerisch, oft ästhetisch frei |
| Hat meist ein Ziel (z. B. Was ist die Stimmung und was die Kernbotschaft) | Hat oft keine Zweckbindung |
| Elemente sind oft geordnet & gezielt | Elemente sind oft verspielt & zufällig |
| Zeigt Stimmungen, Farben, Stilwelten | Erzählt mehr durch visuelles Spiel |
Wie erstelle ich ein Moodboard zu einem Bibeltext?
Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, um kreativ aus einem Bibeltext ein Moodboard zu gestalten:
1. Wähle den Bibeltext aus
- Lies einen bestimmten Abschnitt (z. B. Psalm 23 oder Matthäus 5,1–12).
- Frage dich: Welche Hauptthemen oder Gefühle werden transportiert? (z. B. Trost, Licht, Hoffnung, Demut)
2. Analysiere den Text auf Schlüsselwörter und Bilder
- Markiere starke Begriffe, Symbole und Metaphern (z. B. „grüne Auen“, „Licht“, „Wasser“, „Wüste“, „Hirtenstab“).
- Überlege, welche Farben, Materialien oder Bilder diese Begriffe in dir hervorrufen.
3. Sammle visuelles Material
- Suche Bilder, Farben, Texturen (aus Zeitschriften, Internet oder selbst gezeichnet).
- Auch Stoffe, Naturmaterialien oder Farbproben können eingebunden werden.
4. Bestimme eine Farbwelt
- Überlege: Welche Farbstimmung passt zu deinem Text? (z. B. warme Töne für Hoffnung, kühle Töne für Ruhe)
- Entscheide dich für 2–4 Hauptfarben.
5. Wähle passende Typografie oder Worte
- Füge kurze Zitate aus dem Bibeltext hinzu.
- Du kannst auch handgeschriebene Worte oder stilisierte Schriftarten einsetzen, die die Stimmung betonen.
6. Ordne deine Elemente
- Lege alles auf einem DIN-A3- oder DIN-A2-Bogen (oder digital) aus.
- Achte auf eine gewisse Struktur, z. B. nach Themen, Emotionen oder Bibelstellenabschnitten.
7. Reflektiere die Wirkung
- Schaue dir dein Moodboard an: Entspricht es der Botschaft oder Atmosphäre des Bibeltextes?
- Ergänze oder streiche ggf. Elemente.
8. (Optional) Teile oder nutze es weiter
- Nutze das Moodboard z. B. für eine Andacht, ein Kunstprojekt oder als Inspiration für eine Predigt, eine Meditation oder ein Theaterstück.
Hier noch drei konkrete Beispiele für Moodboards, jeweils bezogen auf einen anderen Bibeltext als Orientierung oder Hilfe zum Verständnis.
1. Psalm 23 – „Der Herr ist mein Hirte“
Thema: Geborgenheit, Vertrauen, Führung
Farbwelt: Sanftes Grün, warmes Beige, Himmelblau, weiches Grau
Bildsprache:
- Sanfte Hügel, grüne Auen, Schafe
- Lichtstrahlen durch Bäume
- Hirtenstab, stilles Wasser
- Fußspuren auf einem Pfad
Materialien/Elemente:
- Naturstoffe wie Wolle
- Bibelzitat in schöner Handschrift: „Du führst mich zum frischen Wasser“
- Geräuschbild: Vogelgezwitscher, Wind im Gras (wenn digital möglich)
2. Jesaja 40,31 – „Die auf den Herrn harren…“
Thema: Hoffnung, Erneuerung, Stärke
Farbwelt: Himmelstöne, Weiß, Gold, tiefe Nachtblau-Töne
Bildsprache:
- Adler in der Luft
- Weite Himmel, Aufbruch in der Morgendämmerung
- Starke, wachsende Pflanzen oder Bäume
Materialien/Elemente:
- Glänzendes Papier oder Goldfolie für Akzente
3. Matthäus 5,14 – „Ihr seid das Licht der Welt“ (Bergpredigt)
Thema: Licht, Wirkung, Verantwortung
Farbwelt: Helles Gelb, Weiß, Orange, Nachthimmelblau
Bildsprache:
- Stadt auf einem Berg bei Nacht
- Kerzenflamme oder Laterne
- Lichtreflexe auf Wasser
- Menschen, die einander helfen
Materialien/Elemente:
- Transparentpapier oder Glanzpapier
- Kleine Lichter oder LED
Gruppenversion:
Wenn du das als Gruppe machst, brauchst du im Grunde nur ausreichend Platz und deutlich mehr Material.
Event:
Für ein Event kannst du danach eine Ausstellung der Kunstwerke einplanen und kurze Workshops für Teilnehmende an dem Event anbieten.
Bei „Just do“ geht es darum, Bibeltexte zu lesen und dann nicht lange nachzudenken, sondern einfach machen! Ins Tun kommen fällt uns oft beim Lesen der Bibel schwer.
Daher hier ein paar Textbeispiele. Die Methode kannst du aber im fortgeschrittenen Modus auf fast alle Texte beziehen. Du benötigst vermutlich dann nur etwas mehr Zeit, um herauszufinden, was du anhand des Textes konkret tun kannst.
Achte bei der Methode darauf, dass du dich und deine Mitmenschen nicht überforderst. Du solltest also nicht mehrmals die Woche einen neuen Text lesen und dann direkt loslegen. Sondern lieber bewusst und zielgerichtet. Nimm dein „Machen“ ernst und schau, dass du wirklich was bewegt bekommst.
Ein paar Beispiele:
Wir haben bewusst auf Versangaben verzichtet, damit ihr auch auf individuelle „Just do“-Dinge kommen könnt und die Entdeckungen intensiver sind.
Epheser 4
- Heute bewusst freundlich zu anderen sein: ein Lächeln, ein ermutigendes Wort oder eine kleine Hilfsbereitschaft.
- Jemandem vergeben, mit dem man einen Konflikt hatte.
Galater 6
- Einer Person, die Hilfe benötigt, konkret unterstützen: Einkäufe tragen, ein offenes Ohr schenken, praktische Unterstützung anbieten.
1. Thessalonicher 5:
- Schreibe am Abend drei Dinge auf, für die du heute dankbar bist.
- Sprich ein Dankgebet für die Segnungen des Tages.
Matthäus 25:
- Spende Lebensmittel, Kleidung oder Geld an Bedürftige.
- Besuche oder schreibe jemandem, der einsam oder krank ist.
1. Mose 2:
- Achte bewusst auf die Natur: Müll aufsammeln, nachhaltig handeln, Zeit im Grünen verbringen.
- Pflege Pflanzen oder einen Garten als Ausdruck von Verantwortung.
1. Johannes 3:
- Zeige deine Liebe durch konkrete Taten, z. B. eine kleine Überraschung, einen Brief, oder indem du Zeit mit jemandem verbringst.
Matthäus 5:
- Bete für jemanden, mit dem du Schwierigkeiten hast.
- Schreibe dieser Person eine Nachricht oder versuche, mit ihr Frieden zu schließen.
Hebräer 13:
- Überprüfe deinen Besitz und gib Dinge weiter, die du nicht mehr brauchst.
- Nimm dir Zeit, das zu schätzen, was du schon hast, anstatt nach mehr zu streben.
Psalm 46:
- Plane heute fünf bis zehn Minuten Ruhe ein, ohne Ablenkung, um einfach zu sein und Gottes Gegenwart zu spüren.
- Schalte bewusst das Handy aus und finde einen stillen Ort.
Matthäus 7:
- Versuche heute, niemanden negativ zu bewerten – weder laut noch in Gedanken.
- Stattdessen versuche, das Positive in anderen zu sehen und es zu schätzen.
Die Bibel malt mit ihrem Worten oft Bilder und erzählt lebensnahe Geschichten. All das hat eine große Inspirationskraft, die sich in eigene Bilder übersetzen kann.
1. Einstieg
Am Anfang bietet es sich an, die Verbindung von Kunst und Bibel anzuschauen. Seit jeher haben Künstler zu Bibelgeschichten gemalt. Das Anschauen von verschiedenen Bibelausgaben kann das veranschaulichen. Man kann bei alten illustrierten Ausgaben anfangen und auch neue fotografische Projekte (z.B. www.alabasterco.com) gemeinsam betrachten.
2. Text- und Motivwahl
Lasse die Jugendlichen eine biblische Geschichte oder einen Vers auswählen, die/der sie besonders anspricht. Hierfür ist es hilfreich eine Vorauswahl zu treffen oder sich gemeinsam auf eine Erzählung oder ein Kapitel zu verständigen. Ermutige die Teilnehmenden, den gewählten Text in verschiedenen Bibelausgaben/-übersetzungen zu lesen und zu vergleichen. Fordere die Teilnehmenden auf, über die persönliche Bedeutung des Textes nachzudenken und ihre Gedanken zu notieren.
3. Umsetzung
Mit den Smartphone-Kameras sind Jugendliche i.d.R. bestens ausgestattet, um direkt loszulegen. Wichtig ist, dass niemand fotografiert werden sollte, der das nicht möchte. Die Einholung der Erlaubnis der Eltern ist ebenfalls zu beachten, wenn minderjährige Personen zu sehen sind.
4. Buchgestaltung
BookCreator ist eine benutzerfreundliche App, die sich hervorragend für dieses Projekt eignet:
- Öffne BookCreator im Browser oder als App.
- Füge Seiten für die Geschichten oder Verse hinzu.
- Nutze die integrierten Werkzeuge zum Einfügen von Text und Bildern.
- Ermögliche den Jugendlichen, ihre eigenen Fotos einzufügen, Illustrationen zu zeichnen oder Bilder aus der sicheren Bibliothek von BookCreator zu verwenden.
- Ergänzend können die Bibelverse als Text eingefügt werden. Auch eigene Kommentare oder Gedanken der Teilnehmenden können das Buch anreichern.
- Das Buch kann als PDF oder als E-Book mit den Teilnehmenden geteilt werden. Eine Veröffentlichung innerhalb der Gemeinde ist nur möglich, wenn die Rechte der verwendeten Texte, Bilder oder anderen Elemente geklärt sind.
Dieses Projekt fördert nicht nur das Verständnis biblischer Geschichten, sondern auch die Kreativität und digitale Kompetenz der Teilnehmenden. Es schafft eine persönliche Verbindung zu den Geschichten der Bibel.
Ein Hörbuch mit Jugendlichen aufzunehmen, ist ein spannendes und lehrreiches Projekt, das die Teilnehmer auf vielfältige Weise fordert und fördert. Und welches Buch eignet sich dafür besser als die Bibel. Es bietet die Möglichkeit, sich intensiv mit biblischen Texten auseinanderzusetzen, kreative und technische Fähigkeiten zu entwickeln. Dieses Projekt fördert die Auseinandersetzung mit biblischen Texten und kann das Selbstbewusstsein der Jugendlichen stärken.
Textauswahl
- Wähle gemeinsam mit den Jugendlichen Bibelpassagen aus, die sie besonders ansprechen oder die thematisch zusammenpassen. Es können auch ganze Bücher ausgewählt werden. Gut eignen sich Psalmen oder Geschichten (z.B. Markusevangelium).
- Berücksichtige dabei die Länge der Texte und die verfügbare Zeit für das Projekt.
- Achte auf eine Bibelübersetzung, die die Jugendlichen verstehen, z.B. BasisBibel.
Inhaltliche Auseinandersetzung
- Die ausgewählten Texte sollten vorab gemeinsam gelesen und besprochen werden.
- Ermutige die Jugendlichen, den historischen und kulturellen Kontext zu recherchieren.
- Besprecht die Bedeutung und Relevanz der Texte für das heutige Leben. Für die Motivation der Jugendlichen ist es wichtig, dass sie einen Bezug zu dem Text haben.
Aufnahme
- Verteile die Textabschnitte (oder Rollen) unter den Teilnehmenden.
- Übe das Vorlesen und die Aussprache schwieriger Wörter.
- Richte einen ruhigen Aufnahmeort ein, idealerweise mit schalldämpfenden Materialien (Schaumstoff, Teppich, Bettdecken). Der Aufnahmeraum sollte wenig Hall haben, hierfür kann man große Räume abtrennen und eine Art kleine Aufnahmekabine einrichten.
- Nutzt ein gutes Mikrofon, vielleicht hat die Band in der Gemeinde eines, dass ihr ausleihen könnt.
- Jeder Jugendliche der Gruppe sollte beteiligt sein. Wer nicht liest, kann auf die Technik achten, den Text mitlesen und auf Fehler achten.
- Wer spricht, sollte viel trinken.
Nachproduktion
- Schneide die Aufnahmen und entferne Fehler oder Störgeräusche.
- Für einen Hörspielcharakter kann man bei Erzählungen dezente Hintergrundmusik oder Soundeffekte hinzufügen, wo es passend erscheint.
- Lasse die Jugendlichen beim Editieren mithelfen und ihre Ideen einbringen.
Wenn alle Beteiligten einverstanden sind, kann die Hör-Bibel auch der Gemeinde vorgestellt werden. Dabei ist zu beachten, dass moderne Bibelübersetzungen urheberrechtlich geschützt sind. Bei einer Veröffentlichung müssen die Herausgebenden um Genehmigung gebeten werden.
Die Losungen sind kurze, knackige Bibelverse für jeden Tag. Sie sind wie ein geistlicher Energieschub für deinen Alltag:
- Minimalistisch: Nur ein paar Worte, aber mit Tiefgang. Perfekt für unsere schnelllebige Zeit!
- Kostenlos: Du kannst die Losungen gratis nutzen. Kein Abo, keine versteckten Kosten.
- Digital und analog: Ob du lieber eine App auf deinem Smartphone checkst oder ein Buch in der Hand hältst – du hast die Wahl.
Mit den Losungen kannst du die Bibel in kleinen Häppchen kennenlernen oder easy eine Routine entwickeln. Morgens beim Frühstück, in der Bahn oder abends vor dem Schlafengehen – such dir einfach einen Moment, der zu dir passt. Es gibt sogar spezielle “Losungen für junge Leute”.
Wenn du die Losungen liest, bist du Teil einer riesigen Community. Über eine Million Menschen weltweit lassen sich täglich von den Losungen inspirieren.
Die Losungen bestehen aus drei wesentlichen Komponenten:
- Tageslosung
- wird aus ca. 1.800 alttestamentlichen Bibelversen ausgelost
- zufällig für jeden Tag des Jahres ausgewählt
- dient als täglicher Leitvers
- Lehrtext
- stammt aus dem Neuen Testament
- wird thematisch passend zur Tageslosung ausgesucht
- Dritter Text
- meist ein Lied, Gebet oder bekenntnisartiger Text
- soll zum Gebet hinführen
- ergänzt die Bibelverse
Besonderheiten
- werden jährlich von der Herrnhuter Brüdergemeine ausgelost
- drei Jahre im Voraus vorbereitet
- seit 1728 von Nikolaus Ludwig von Zinzendorf initiiert
- mittlerweile in 60 Sprachen verfügbar
Weitere Infos findest du unter: www.losungen.de
Als Buch kannst du die Losungen online oder in vielen Buchhandlungen kaufen.
Infos zur App und anderen digitalen Möglichkeiten findest du unter: www.losungen.de/digital
Bibeltexte sind immer in bestimmte Situationen und meist zu einem konkreten Zielpublikum gesprochen worden. Dennoch dürfen wir erleben, dass sie auch heute noch mitten in unser Leben hineinsprechen und damit in ganz unterschiedliche Situationen.
Mit dieser Methode kannst du einen Bibelvers in seiner Vielfalt wahrnehmen und unterschiedliche Facetten entdecken.
Wie es geht:
1. Such dir einen Bibelvers aus. Dafür kannst du
- Die Bibel einfach an einer Stelle aufschlagen, mit dem Finger auf eine Stelle tippen und den Vers unter deinem Finger nehmen.
- Den Losung- oder Lehrtext des Tages nehmen. Diese findest du zum Beispiel hier (die Losungen).
- Einen Vers aus der Liste unten wählen.
2. Mach von dem Vers ein Foto oder schreib ihn dir ab.
3. Lies den Vers ein paar Mal laut vor.
4. Nun such dir sieben verschiedene Orte in deinem Zuhause, deiner Nachbarschaft, deiner Stadt.
Geh zu den einzelnen Orten hin, komme einen Moment zur Ruhe und lies dann den Vers ein paar Mal. Wenn es gerade passt, gerne auch laut.
Ideen für Orte sind zum Beispiel: ein Schulhof, eine Bank im Park, auf einem Spielplatz, an einer Straßenecke, im Bus oder in der Straßenbahn.
5. Überlege, ob du eine Verbindung zwischen diesem Vers und diesem Ort findest.
In welche Situation spricht er hier hinein? Wo kann der Vers andocken? Du kannst deine Gedanken vielleicht in den Notizen auf deinem Handy festhalten.
6. Beende diese Zeit, indem du deine Gedanken mit Gott besprichst.
Vorschläge für Bibelverse für diesen Zugang:
- Matthäus 7,12
- Philipper 4,6-7
- Psalm 23,1
- Jakobus 1,19
- Sprüche 3,5-6
- Matthäus 6,34
- Micha 6,8
- Römer 12,21
- Galater 6,2
- Johannes 14,27