Hier kommt die erste Themenreihe der JUMAT 3/2021. Es geht in sieben Lektionen um die Ich-bin-Worte Jesu:
Lektion 1 Johannes 6,35 Ich bin … Brot des Lebens
Lektion 2 Johannes 8,12 Ich bin … das Licht der Welt
Lektion 3 Johannes 10,9 Ich bin … die Tür
Lektion 4 Johannes 10,11. (14) Ich bin … der gute Hirte
Lektion 5 Johannes 11,25 Ich bin … die Auferstehung und das Leben
Lektion 6 Johannes 14,6 Ich bin … der Weg und die Wahrheit und das Leben
Lektion 7 Johannes 15,5 Ich bin … der Weinstock
Außerdem gibt es einen Grundsatzartikel: Der Jungscharleiter ist Hirte und damit Vorbild!
Die einzelnen Lektionen sind nach dem gleichen Schema aufgebaut: Im ersten Teil sind exegetische Überlegungen, sowie Gedanken über Auswirkungen des Textes für mich und für die Kinder. Im zweiten Teil geht es um die praktische Umsetzung. Dabei werden mehrere Methoden und Möglichkeiten vorgestellt, wie die Umsetzung aussehen kann. Zur Vertiefung stehen jeweils 7 unterschiedliche Elemente zur Verfügung: Wiederholung, Gespräch, Merkvers, Gebet, Kreatives, Spielerisches und Rätselhaftes.
Das Ziel
Starter
Die Kinder sollen erfahren, dass Jesus uns wichtige Versprechen gibt, die wir glauben dürfen.
Checker
Die Kinder sollen erfahren, dass der Glaube an Jesus das Leben prägt.
Der Text an sich
Ich bin die Auferstehung und das Leben; wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Gerade ist ein guter Freund von Jesus gestorben, seine beiden Schwestern sind verzweifelt und voller Trauer. Martas Glaube an die Auferstehung kann auch ihre aktuelle Trauer nicht abschwächen. Gerade dann kommt Jesus und bezieht die Auferstehung auf sich und seine Person – alles ist von ihm abhängig. Nicht nur die Auferstehung, auch das Leben ist eng verbunden mit Jesus. Er beweist seine Aussage kurze Zeit später mit der Auferweckung von Lazarus und verbreitet dadurch Trost und Hoffnung. Aber auch ohne diese Ereignisse drumherum verbreitet Jesus Hoffnung: der Glaube an Jesus bringt DAS Leben. Nicht nur irdisches Leben, sondern ewiges Leben. Hier passt auch der vielleicht berühmteste Vers aus der Bibel (Joh 3,16): So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Dieses ewige Leben ist nicht bloß eine Zeitangabe, sondern eine Qualitätsbeschreibung. Leben, das von Gott kommt; ein Leben, das der große, ewige und liebende Gott uns Menschen ermöglicht durch seinen Sohn Jesus.
Diese wunderbare Hoffnung ist geknüpft an eine einzige Bedingung: an den Glauben. Und nicht irgendeinen Glauben, sondern den Glauben an Jesus (wer an MICH glaubt, …). Durch diesen Schlüssel wird die Tür zum Leben geöffnet. Der Glaube ist ganz konkret (Hebr 11,1): eine Überzeugung, von Dingen, die man nicht sieht. Da Jesus nicht mehr sichtbar auf der Erde ist, ist das Überzeugtsein von seinem Leben auf der Erde, seinem Tod und seiner Auferstehung schon der Schritt zum Leben. Auch die anderen „Ich bin“-Worte sind mit dem Leben verknüpft: Ich bin das Brot des Lebens (Joh 6,35); […] wird das Licht des Lebens haben (Joh 8,12); der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe (Joh 10, 11). Das Leben von Jesus und auch sein Sterben und Auferstehen sind Bedingung für das Leben, das auch dann noch weitergeht, wenn man gestorben ist. Oder wie Paulus sagen würde: „Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir“ (Gal 2,20). Und das Leben auf der Erde ist geprägt durch den Glauben an Jesus, den Sohn Gottes.
Der Text für mich
Die Aussage von Jesus ist für mich eine ganz konkrete Herausforderung: Ich bin die Auferstehung und das Leben; wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Kurz danach fragt er seine Gesprächspartnerin: Glaubst du das? Was ist meine Antwort auf diese Frage?! Natürlich glaube ich das! Und was sind die Auswirkungen davon auf mein Leben? Wenn ich Jesus glaube und er die Auferstehung und das Leben ist, dann verändert das alles. Ich habe eine lebendige Hoffnung, die über mein Leben hier auf der Erde hinaus geht, durch die Auferstehung und das Leben, das nach der Auferstehung folgt; aber ich habe auch ein hoffnungsvolles und erfülltes Leben hier auf der Erde. Das Leben ist das, wofür mein Herz schlägt. Wenn mein Herz im Alltag für Jesus schlägt, dann bin ich begeistert für ihn und kann diese Begeisterung auch hoffentlich immer wieder an die Kinder und Teens weitergeben; so dass sie meine Begeisterung spüren und selbst für Jesus begeistert werden.
Der Text für dich
Allgemein: Viele Kinder in diesem Alter erleben das erste Mal, dass sie sich bewusst mit dem Thema Tod auseinandersetzen müssen (z. B. Tod von Angehörigen oder Haustieren). Die Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod ist in der Regel nicht präsent. Da das Thema Tod in allen Familien unterschiedlich besprochen wird, versuche in der Programmgestaltung flexibel zu sein und sensibel auf die Reaktionen der Kinder einzugehen.
Starter
Für einige Kinder ist der Glaube an Jesus in ihrem Alltag sehr fern. Warum soll ich überhaupt an Jesus glauben? Warum lohnt sich das und was bringt mir das persönlich? Vielleicht sind diese Fragen nicht bewusst vorhanden, doch sie sind ein wichtiger Punkt, um ihnen den Glauben nahe zu bringen. Wenn Jesus verspricht, dass er das Leben ist, und das ewige Leben über den Tod hinaus für diejenigen ist, die an ihn glauben, dann ist das für jeden Menschen besonders wichtig. Sei dir als Mitarbeiter bewusst, dass diese Fragen nach Leben und Tod auch bei Kindern schon da sind – und geh sensibel mit den Erklärungsmöglichkeiten der Kinder um. Wenn sie Fragen nach dem Tod in ihren Familien bis jetzt ohne Jesus beantwortet haben, dann hast du die Chance, ihnen deine Hoffnung durch Jesus zu erzählen.
Checker
Auferstehung wird von vielen direkt mit der Ostergeschichte verknüpft. Sie wissen, dass Jesus stärker ist als der Tod und dass er das ewige Leben schenkt. Trotzdem ist der Tod bei allen Kindern ein sensibles Thema. Manche haben sich damit vielleicht noch gar nicht beschäftig, bei anderen ist eventuell jemand Nahestehendes gestorben. Hilf den Kindern dabei, ihren Glauben und ihre Hoffnung zu bestärken und Fragen stellen zu können.
Der Text erlebt
Hinführung
Idee 1
Ein guter Einstieg in das Thema Vertrauen / Glaube sind Vertrauensspiele.
Ein Mitarbeiter holt ein Kind zu sich und verspricht ihm, dass er / sie das Kind auffangen wird, wenn sich das Kind fallen lässt. Dafür muss das Kind wenige Schritte vor dem Mitarbeiter stehen (mit dem Rücken in seine / ihre Richtung) und sich rückwärts fallenlassen. Wenn die Gruppe das hergibt, dann können sich die Kinder auch in Teams zusammenfinden und das gegenseitig ausprobieren. Wichtig hierbei: Der Mitarbeiter sollte kräftemäßig in der Lage sein, das Kind aufzufangen. Das Kind darf sich erst nach einem verabredeten Start in Richtung des Mitarbeiters fallenlassen. Wenn die Kinder sich gegenseitig auffangen wollen, dann auf eine sinnvolle Zuordnung achten.
Mögliche Variante: Ein Kind steht auf einem Tisch und mehrere Mitarbeiter vor dem Tisch. Die Mitarbeiter stehen sich gegenüber und strecken ihre Arme so nach vorne, dass eine Fläche entsteht. Das Kind kann sich jetzt vom Tisch aus rückwärts auf die Arme der Mitarbeiter fallen lassen.
Idee 2
Die Kinder bekommen die Augen verbunden und sollen sich mit geschlossenen Augen finden: dabei bilden sie eine Schlange, indem sie ihre Hände auf die Schultern des Vorderkindes legen und ihm / ihr folgen. Ein Mitarbeiter gibt der Kinderschlange durch Kommandos die Richtung vor und warnt vor möglichen Hindernissen.
Verkündigung
Fragerunde mit Bildern
Heute geht es nicht um eine Geschichte, sondern um abstraktere Themen; daher ist es wichtig, dass die durchführenden Mitarbeiter besonders ihre Zielgruppe vor Augen haben bei der Vorbereitung und Durchführung und das Material entsprechend anpassen.
In der Mitte liegen verschiedene Bilder (am besten aus Zeitschriften sammeln, z. B. Spielsachen, Lebensmittel, Medikamente, Menschen, Tiere, Bastelsachen, Bücher, Autos, Möbel …). Die Kinder dürfen sich alle Bilder in Ruhe anschauen. Anschließend stellt ein Mitarbeiter Fragen:
- Wenn du dir drei Sachen hiervon aussuchen darfst, welche würdest du nehmen?
- Stell dir vor, gleich kommt dein bester Freund zu Besuch, was würdest du dir dann aussuchen?
- Stell dir vor, du bist ganz dolle krank, was würdest du dann nehmen?
Die Fragen sollen nicht alle auf einmal gestellt werden, sondern nacheinander, so dass die Kinder sich in Ruhe für jede Frage Bilder aussuchen können. Beim Beantworten gerne darauf achten, dass möglichst alle Kinder mal drankamen – wenn sie ihre Auswahl begründen möchten, dann gerne zulassen, wenn nicht, dann einfach nur die Bilder zeigen lassen.
In unterschiedlichen Situationen sind für uns unterschiedliche Dinge wichtig. Wenn wir uns aus allen Dingen auf der Welt aussuchen dürfen, was wir gerne haben wollen, dann zeigt sich oft, was in meinem Herzen eine wichtige Rolle spielt (Herzsymbol hinlegen). Wenn meine Freunde zu Besuch kommen, dann machen wir oft Dinge zusammen, die uns Freude bereiten. Wenn ich krank bin, dann bin ich froh, wenn jemand bei mir ist, der mich tröstet und ich Medizin bekomme. Wenn ich mal ganz allein bin, dann wünsche ich mir, dass jemand kommt und ich nicht mehr allein sein muss. Und wisst ihr, was richtig genial ist: es gibt jemanden, der immer bei mir ist. In den letzten Wochen habt ihr schon von diesem Jemand gehört: Jesus. Aber von Jesus habe ich jetzt kein Bild hier hingelegt. Wisst ihr warum nicht? Weil wir ihn nicht so sehen können, wie z. B. die Spielsachen (jetzt alle Bilder vom Anfang wegräumen, so dass nur noch das Herz zu sehen ist). Aber trotzdem ist er da. Wie kann das sein? Wie kann ich mir sicher sein, dass Jesus da ist? Wisst ihr, warum ich mir da ganz sicher bin: weil ich an ihn glaube. In der Bibel, Gottes Brief an uns Menschen, stehen viele Geschichten über Jesus drin. Dort steht auch ein ganz großes Versprechen von ihm: Ich bin die Auferstehung und das Leben (Zettel mit dem Versprechen ausrollen und hinlegen). Habt ihr das Wort Auferstehung schon mal gehört? Antworten der Kinder abwarten.
Genau, auferstehen heißt, dass jemand gestorben ist und dann wieder lebt. Wenn Jesus sagt, dass er die Auferstehung ist, dann heißt das auch, dass Jesus stärker ist als der Tod! Das ist er, weil er Gott ist und alles kann. Und Jesus sagt auch, dass er das Leben ist. Jesus ist das Leben, weil er allen Menschen das ewige Leben geben möchte. Das ewige Leben ist auch ein Versprechen von ihm (Zettel mit dem Versprechen weiter ausrollen): Wer kann das mal vorlesen? Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Jesus verspricht uns, dass wir für immer leben werden, weil er das Leben ist und stärker ist als der Tod. Das heißt nicht, dass wir auf der Erde Millionen von Jahren alt werden. Bestimmt habt ihr auch schonmal mitbekommen, dass jemand gestorben ist (eventuell haben die Kinder hier Redebedarf, je nach Situation entweder hier schon reden lassen oder später in der Gesprächsrunde vertiefen). Aber das heißt, dass wir keine Angst vor dem Tod haben müssen, weil Jesus uns verspricht, dass wir dann bei ihm leben werden.
Jetzt haben wir hier unser Herz – wo auch das drin ist, was uns am wichtigsten ist und was wir dolle lieb haben und hier auf der anderen Seite das Versprechen von Jesus, dass er stärker ist als der Tod und jedem das ewige Leben geben möchte. Und es gibt eine Sache, die die beiden Dinge zusammenbringen kann: (Papierschlüssel mit dem Wort GLAUBEN drauf zeigen) Glauben. Wir dürfen an Jesus glauben und ihm vertrauen, dass er da ist und seine Versprechen hält. Das sieht dann ungefähr so aus: wenn wir an Jesus glauben, dann kann man sich das so vorstellen, dass eine Tür in meinem Herzen aufgemacht wird und die Versprechen von Jesus in mein Herz hineinkommen (mit dem Papierschlüssel so tun, als wenn eine Tür in dem Papierherzen aufgeschlossen wird, dann eine Tür im Herzen aufklappen und das Papier mit dem Versprechen hindurch ziehen). Wenn ich weiß, dass Jesus mir persönlich das ewige Leben schenkt, dann darf ich auch ganz sicher wissen, dass Jesus immer bei mir ist und das Wichtigste in meinem Leben ist. Das macht mich froh, auch wenn ich traurige Dinge erlebe und das tröstet mich auch dann.
Die andere Idee
Mitarbeiter kommen rein in den Raum und streiten darüber, was man im Leben alles erlebt haben muss, damit man „wirklich gelebt“ hat. Einer ist z. B. ein Sportfreak und beharrt auf Sport, einer verreist gerne und behauptet, dass man nur gelebt hat, wenn man alle Länder der Welt gesehen hat. Ein weiterer sagt, dass man nur dann richtig lebt, wenn man jeden Tag eine gute Tat tut usw. Die Diskussion wird immer lauter und lauter, bis die Mitarbeiter fast übereinander herfallen. Einer der Mitarbeiter verhält sich die ganze Zeit ruhig und mischt sich in die hitzige Diskussion nicht ein. Irgendwann fällt das den anderen auf und sie sprechen ihn darauf an. „Warum sagst du gar nichts? Was macht denn das Leben für dich lebenswert?“ Jetzt kann der Mitarbeiter sein christliches Lebenszeugnis geben und von seinem Glauben an Jesus berichten.
Der Text gelebt
Wiederholung
Legt die drei Symbolbilder wieder einzeln in die Mitte (Herz mit Türöffnung, Schlüssel und Versprechen von Jesus) und lasst von einzelnen Kindern die symbolische Handlung wiederholen: der Glaube schließt unser Herz für die Versprechen von Jesus auf.
Gespräch
Bezug nehmen zu dem Vertrauensspiel am Anfang. Warum hast du dich getraut / nicht getraut, dich fallenzulassen? Fiel es dir leicht, dem Mitarbeiter zu vertrauen und ihm zu glauben, dass er dich auffängt bzw. richtig führt? Würdest du jedem einfach so vertrauen? Bei den vielen Geschichten über Jesus in den letzten Wochen – fällt es dir leicht, Jesus zu vertrauen? Kannst du Jesus glauben, dass er stärker ist als der Tod und dir ewiges Leben gibt? Was glaubst du, wie Jesus ist? Die Fragen sind nur Beispielfragen, wie eventuell das Gespräch auf den persönlichen Glauben der Kinder gelenkt werden kann. Vielleicht sind auch bei manchen Kindern Angehörige oder Freunde gestorben; dann kann ihnen hier Raum gegeben werden, um über ihre Sorgen / Trauer zu sprechen (eventuell auch in kleinerem Rahmen).
Merkvers
Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Johannes 11,25
Der Merkvers liegt in Puzzlestücken in der Mitte. Die Aufgabe der Kinder ist es nun, den Merkvers richtig zusammenzufügen.
Gebet
Jedes Kind kann sich ein Bild vom Anfang aussuchen (Spielzeug usw.) und Jesus dafür danke sagen, dass er immer da ist, auch wenn diese Dinge nicht immer bei uns sind / dass er wichtiger ist als alles andere. „Danke, Jesus, dass du immer da bist, auch wenn … nicht da ist.“/ „Danke, Jesus, dass du wichtiger bist als …“
Kreatives
Das Versprechen von Jesus als Schriftrolle basteln, die die Kinder mit nach Hause nehmen können. Dafür braucht man pro Kind zwei Zahnstocher und vier Perlen, die an die Enden der Zahnstocher geklebt werden, und einen Zettel mit dem Merkvers. Der Zettel wird jeweils am Ende um die Zahnstocher gefaltet und dort festgeklebt. Dann kann der Zettel aufgerollt und wie eine Schriftrolle gelesen werden.
Spielerisches
Abwandlung von dem Spiel „Ich packe meinen Koffer“. „Ich verreise auf eine einsame Insel und nehme mit …“
Rätselhaftes
Aus den Schlagworten des Merkverses und des Themas kann ein Suchsel im Internet erstellt werden (mögliche Worte: Jesus, Glauben, Auferstehung, Leben, Ich, Herz, Vertrauen)
(T)Extras
Lieder
- Ich glaube an Gott, den Vater
- Sei mutig und stark
Kreatives
Bastelt aus den benutzten Bildern eine Collage: die Anfangsbilder sind der Hintergrund. Darüber kommt das Herz mit dem Schlüssel und dem Versprechen von Jesus.
Das Kleingruppen-Material beinhaltet: Hintergrundinfos zum Text, einen Bezug zur Zielgruppe und Ideen zur Gestaltung der Kleingruppenzeit.
Die Kleingruppen laufen nach einem Rotationsprinzip. Jeder Kleingruppe wird von mind. einem Mitarbeitenden begleitet und läuft von Station zu Station. Durch ein Signal vom Zeitwächter wird den Gruppen signalisiert, dass sie zur nächsten Station aufbrechen. Je ein weiterer Mitarbeitender ist bei einer der 5 Stationen die je 7 Minuten dauern:
- Gespräch inkl. Fragen
- Spiel
- Kreatives
- Bibellesen und Gebet
- Extra/Spezial
Gedanken und Hintergrundinformationen zum Text
In dem Kapitel zuvor hat Jona in Ninive die Botschaft von Gott übermittelt, dass er die Stadt in 40 Tage vernichten wird, wenn sie nicht zu Gott kommen.
Hier gibt Gott der Stadt Ninive eine zweite Chance, sich zu bessern, denn die Bewohner von Ninive beten Götzen an und verhalten sich nicht im Sinne von Gott. Und zu Jonas Erstaunen bekennen die Bewohner ihre Fehler und tun Buße. Gott freut sich darüber und verschont die Stadt vom Unheil.
Jona gönnt den Menschen die Gnade Gottes überhaupt nicht. Sie haben es in seinen Augen überhaupt nicht verdient. Er geht grimmig auf einen Hügel, um zu beobachten was mit der Stadt passiert.
Dort schenkt Gott Jona einen Baum (einen Rizinus). Der Baum soll Jona als ein bildlicher Vergleich dienen. Dabei steht der Baum für die Stadt Ninive. Gott freut sich über die Stadt Ninive, als sie zu ihm zurückgekommen sind, so wie sich Jona über den Baum (Rizinus) gefreut hat. Aber ohne die Gnade Gottes wäre die Stadt zerstört, so wie der Rizinus für Jona nicht mehr da ist. Dies soll Jona zeigen, der nicht wirklich gnädig zu den Mensch in der Stadt ist, wie toll Gottes Gnade doch ist.
Ob Jona etwas aus der Geschichte gelernt hat, steht nicht in der Bibel.
Zielgedanke: Gott schenkt Gnade, er gibt jedem eine 2. Chance
Bezug zur Altersgruppe
Für die Kinder wird der Fokus auf die Gnade als Geschenk und auf die Zweite Chance gelegt, die die Stadt Ninive erfährt. Es soll klar werden, dass Gnade ein Geschenk ist, welches sich die Bewohner nicht verdienen können, sondern geschenkt bekommen. Zusätzlich kann man daraus lernen, dass Gott sich wünscht, dass wir zu anderen gnädig sind und ihnen auch die Gnade Gottes gönnen.
Kleingruppen Übersicht
- Station 1: Kreatives
- Station 2: Spezial
- Station 3: Bibellesen und Gebet
- Station 4: Spiel
- Station 5: Gespräch
Hinweis: Die Kleingruppen laufen nach dem Rotationsprinzip. Jeder Kleingruppe wird von einem Mitarbeitenden begleitet und läuft von Station zu Station. Gruppe 1 – startet bei Station 1, Gruppe 2 – bei Station 2 usw. Durch ein Signal vom Zeitwächter (einem Mitarbeitenden) wird den Gruppen nach 7 Minuten signalisiert, dass sie zur nächsten Station aufbrechen.
Station 1: Kreatives „Geschenkbox aus Streichholzschachteln“
- Die Kinder erhalten jeweils eine Streichholzschachtel,
die sie verzieren können. Sie haben die Möglichkeit diese mit Stickern zu bekleben,
mit bunten Papier zu umhüllen oder bei weißen Schachteln, diese anzumalen.
Dazu muss das bunte Papier auf die passende Größe geschnitten werden. Die Sticker können auf dem Tisch verteilt werden, damit man sie gut einsehen kann.
Am Ende sollen sie auf den Boden der Innenschachtel das Wort Gnade schreiben oder ein Herz malen. Die Schachtel wird geschlossen und mit einem Geschenkband umwickelt und damit verschlossen.
Tipp für kleinere Kinder: Kleinere Kinder werden wahrscheinlich Hilfe beim Zubinden der Schachteln brauchen. Damit die Zeit besser genutzt werden kann, sollte man das bunte Papier schon vorher in der Vorbereitung auf die passende Größe schneiden, wie auch das Geschenkband. Vor allem den Kindern der 1./2. Klasse hilft die Vorbereitung zu einem tollen Ergebnis.


Material:
- Streichholzschachteln (bevorzugte Größe: normal kleine)
- Buntes Papier (evtl. passend zu geschnitten) für die Grundfarbe der Schachteln
- Klebestifte (um das Papier auf der Schachtel zu befestigen)
- Scheren (zum zurecht schneiden des bunten Papiers)
- Bunte Stifte (zum Schreiben und Malen auf der Innenschachtel oder auch zum verzieren)
- Sticker (zum zusätzlichen gestalten)
- schmales Geschenkband (zum Verschließen der Schachtel)
Station 2: Spezial „Der Fleck muss weg!“
Anhand eines schmutzigen Stück Stoffs wird den Kindern gezeigt, dass Gnade ein Geschenk Gottes ist und diese nicht verdient werden kann. Mit Gallseife wird der Fleck entfernt und damit Gottes Gnade verdeutlicht.
Vorbereitung: Tische stellen, Putzmittel auf den Tisch platzieren und Decke darüber platzieren, Kaffee auf das Stück weißen Stoff platzieren.
Durchführung: Die Kinder kommen herein und sollen sich um einen Tisch stellen, der sich in der Mitte des Raumes befindet. Der Mitarbeiter holt ein Stück weißen Stoff her, das einen Kaffeefleck hat, hervor. Seht Euch mal dieses Stück Stoff an! Was fällt euch auf? (Der Fleck)
Dieser Fleck steht für das, was wie die Stadt Ninive war. Wie war die Stadt bevor Jona kam? (Böse)
Der Fleck ist all das Böse und Schlechte, das die Bewohner getan haben.
Was meinte Jona denn wie man wieder gut werden kann? (Indem man sich anstrengt, Gutes tut und man sich Gottes Gnade verdient)
Also müssen wir uns anstrengen um das Schlechte zu entfernen.
Dazu sind hier verschiedene Mittel, die man nutzen könnte, um den Fleck sauber zu machen.
Jedes Kind darf sich ein Mittel aussuchen, das zuvor auf einen anderen Tisch unter einer Decke platziert war. Auf dem Tisch steht: Buttermilch, Sonnenmilch, Öl, Rasierschaum, Zahnpasta, Schwamm. Die Kinder sollen hintereinander die einzelnen Möglichkeiten in einem kleinen Bereich des Stoffes ausprobieren. (Keine dieser Mittel werden den Fleck entfernen.)
Und funktioniert es? Wird es sauber?
Nachdem alle Kinder einmal ihr Mittel am Fleck ausprobiert haben geht es weiter:
Egal wie sehr wir uns anstrengen und bemühen der Fleck geht nicht weg! Aber was hat Gott zu Jona gesagt, warum die Bewohner von Ninive noch leben? (Gott hat den Bewohner Gnade geschenkt, sie mussten es nicht verdienen) Gott schenkt ihnen Gnade, da können sie sich und wir selber uns noch so anstrengen, den Fleck (das Schlechte) in uns zu entfernen. Das Einzige, das wir müssen, ist es das Geschenk einfach anzunehmen.
Eine Gallseife wird aus einer Geschenkbox geholt. Und wenn wir dieses Geschenk annehmen dann verschwindet auch der Fleck und auch das Schlechte und das Böse, das uns von Gott trennt.
Mitarbeiter feuchtet den Fleck mit Wasser an und rubbelt mit der Gallseife den Fleck weg und dieser wird sauber. (Experiment endet hier) Wichtiger Hinweis: Nicht zu viel Wasser verwenden!
Falls Zeit übrig ist können noch Fragen gestellt werden…
Material:
- Ein
Ort mit Malunterlagen oder eine Küche (es könnte nass und dreckig werden) - Stück
weißer Stoff (auf dem wird der Kaffeefleck platziert) - gekochter
Kaffee ohne Milch, egal ob er schon abgekühlt ist (Dieser wird mit einem Löffel
auf das Stück Stoff platziert.) - ein
Löffel (für den Kaffee zum dosieren) - Verschiedene
Putzmittel wie: Buttermilch, Öl, Sonnenmilch, Rasierschaum, Zahnpasta, Schwamm (zum
Ausprobieren für die Kinder) - Eine
Decke (um die Putzmittel erstmal verdeckt zu halten, damit der Fokus auf die
Mitte liegt und den Mitarbeiter)
Station 3: Bibellesen „Gummibärchen verdienen“
Vorbereitung:
- Bibel mit Post-Its bearbeiten (dafür auf Bibelserver.com Suchbegriff ,,Gnade” eingeben und von den Ergebnissen einige mit einem Marker und einem Post-It markieren in der Bibel markieren)
- Die Stelle Römer 10, 6 mit einem herausstechenden Post-It markieren
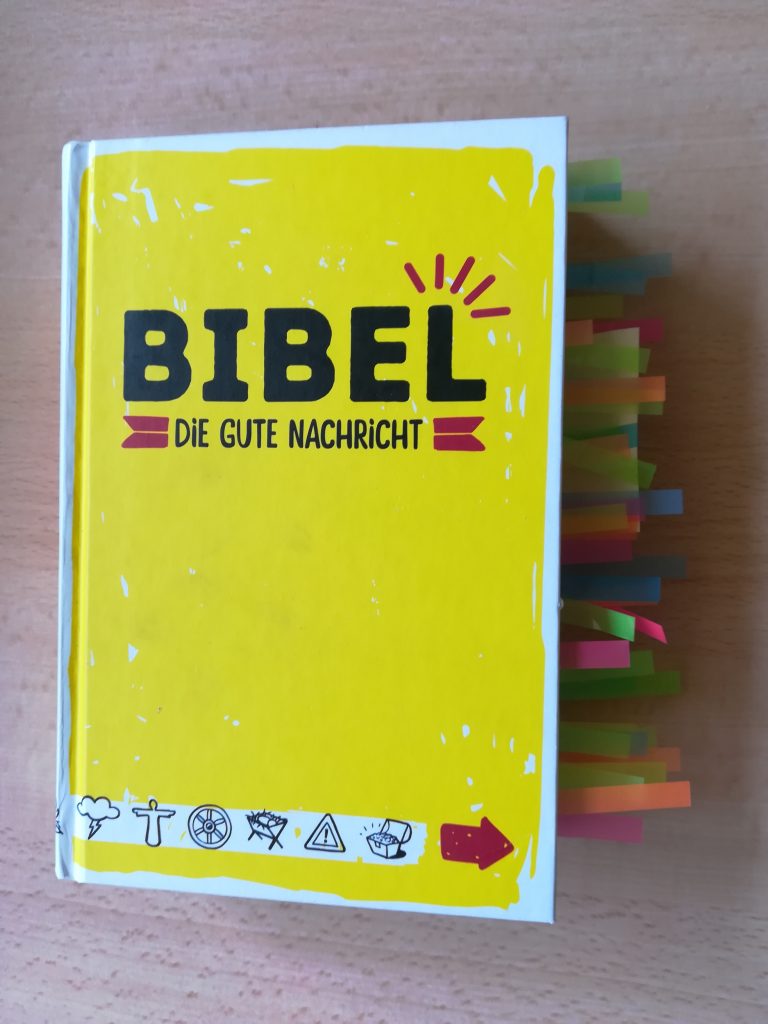
- Packe die markierte Bibel und pro Kind eine Gummibärchenpackung in ein Schuhkarton (soll ein Geschenk darstellen), mache eine Schleife drum und stelle es etwas verdeckt z.B. unter einen Stuhl.
- Lege die übrigen Gummibärchenpackungen zurecht. Mache eine erste Tüte auf.
„Hallo Kinder, hier könnt ihr euch ein Gummibärchen verdienen. Ihr habt die Aufgabe, 5 Liegestütze zu machen.“ Nachdem die Kinder die Aufgabe erfüllt haben, erhalten sie ihren Lohn nach ihrer Leistung. Jedes Kind bekommt so viele Gummibärchen, wie es Liegestütze geschafft hat, max. 5.
Frage an die Kinder: „Ist das Gnade, das, was wir hier gerade gemacht haben?“ Die Kinder Antworten auf die Frage.
Danach erklärst du das Wort Gnade nochmal so, dass es alle verstehen können. „Das Wort Gnade kommt von „gratia“. Das bedeutet für uns sowas wie „Gratis“, also kostenlos, umsonst, geschenkt ohne irgendeine Leistung. Nicht einmal eine Liegestütze muss man leisten. Sonst wäre es ja nicht gratis.“
Jetzt holst du den Schuhkarton hervor machst es geheimnisvoll auf und schenkst jedem Kind eine Tüte Gummibärchen und sie dürfen, wenn sie wollen, diese sofort aufmachen und essen. Während die Kinder essen, holst du die Bibel aus dem Schuhkarton.
„Seht ihr diese Bibel? Die ist an super vielen Stelle markiert. Überall geht es um Gnade, um das was Gott uns schenkt. Gnade muss also etwas sehr Wichtiges sein.
In der Geschichte heute ging es um eine ganze Stadt, die Gnade von Gott bekommen hat. Wir lesen nochmal einen Vers aus der Bibel.“
Ließ aus der markierten Bibel den Vers Römer 10, 6 und bespreche ihn mit den Kindern.
„So ist Gott. Das finde ich toll, dass er die Stadt nicht einfach vernichtet hat. Gnade heißt, wenn du wirklich Mist gebaut hast, vergibt dir Gott trotzdem. Dafür musst du nichts leisten “
Material:
- Kleine Gummibärchenpackungen: für jedes Kind eins plus nochmal 2 Packungen je Kleingruppe.
- Schuhkarton
- Geschenkband
- Marker
- Post-Its
- Bibel mit markierten Bibelstellen
Station 4: Spiel „Schnick Schnack Schnuck Wurm“
Die Kinder verteilen sich im Raum, sodass jeweils zwei Kinder sich gegenüberstehen. Der Mitarbeiter gibt ein Startzeichen, woraufhin die Kinder mit jeweils dem gegenüberstehenden Kind anfangen, Schnick, Schnack, Schnuck (Schere, Stein, Papier) zu spielen. Jedes einzelne Duell geht solange, bis jemand dreimal gewonnen hat. Das Kind, das dabei verliert, kriecht dem Gewinner-Kind unter den Beinen durch, schließt sich dem Gewinner-Kind an und hält sich an seiner Schulter fest. Ab sofort sind sie ein Wurm. Die Kinder, die nicht der Kopf des Wurmes sind (alle die nicht an erster Stelle stehen – sind der Kopf des Wurms) sollten dann die Person anfeuern die vorne Schnick Schnack Schnuck spielen… Der Gewinner sucht sich einen anderen Wurm aus, der frei ist und beginnt eine neue Runde Schnick Schnack Schnuck. Die Kinder, die Teil des Verlierer-Wurms waren, kriechen alle unter allen Kindern des Gewinner-Wurms durch und schließen sich diesem an. Die Kinder, die zu dem Wurm gehören, folgen ihm. Das Spiel endet, wenn nur noch zwei Gruppen gegenüberstehen und einer von ihnen gewinnt und es so nur noch einen Wurm gibt.
Am Ende des Spiels könnt ihr darauf hinweisen, dass Gnade auch bedeutet, sich mit den anderen mitzufreuen. So hat das Anfeuern und Mitjubeln noch eine ganz andere Bedeutung.
Tipp: Die Runde kann relativ schnell vorbei sein, deshalb kann man den Kindern eine zweite Chance geben und das Spiel noch einmal spielen. Vielleicht weist man nochmal konkret darauf hin, dass das Anfeuern und Mitjubeln auch eine Art der Gnade sein kann und man eine zweite Chance bekommt.
Station 5: Gespräch „Interview“
Bei dieser Station sollen die Kinder sich gegenseitig interviewen. Dafür setzten sich die Kinder in einen Kreis. Danach gibt der Mitarbeiter die Mikrofon Attrappe mit dem Fragezettel einem Kind, dieses stellt die erste Frage seinem linken Nachbarn (Uhrzeigersinn) und darf es somit Interviewen. Wenn das andere Kind fertig geantwortet hat gibt er das Mikrofon an die linke Person weiter, die daraufhin die nächste Frage an den nächsten stellt. So wird einmal rund herum jeder gefragt. Wenn noch Zeit da ist, wird eine zweite Runde gestartet.
Vorbereitung: Die Fragen auf einen Zettel schreiben
Fragen:
- „Was
denkst du über Jona? Wie würdest du ihn beschreiben?“ - „Was
denkst du über die Stadt Ninive? Haben sie eine zweite Chance verdient?“ - „Wie muss
sich Jona gefühlt haben, als Gott den Baum zerstört hat?“ - „Was ist
deine Meinung darüber, dass Gott den Baum zerstört hat?“ - „Was ist
für dich ein Geschenk?“ - „Wann und
wem hast du etwas Geschenkt?“ - „Wann hat
dir jemand mal eine zweite Chance gegeben?“ - „Wann
hast du jemandem eine zweite Chance gegeben?“
Variante für 1.und 2. Klasse:
Die Fragen werden vom Mitarbeiter gestellt. Die Kinder können sich melden und der Mitarbeiter nimmt die Kinder dran. Dabei darauf achten, dass jedes Kind eine Chance hat, dranzukommen.
Material:
- Mikro (-Attrappe)
- Zettel mit Fragen
Diese Themenreihe enthält die alle Gruppenstunden zu den Zehn Geboten aus JUMAT 1/17 und 2/17. Die Reihe beginnt mit der Geschichte, in der Mose die 10 Gebote von Gott erhält. Daran schließen sich 10 Einheiten zu den einzelnen Geboten an.
Die einzelnen Einheiten sind nach dem gleichen Schema aufgebaut: Im ersten Teil sind exegetische Überlegungen, sowie eine Beschreibung der Situation der Kinder. Im zweiten Teil geht es um die praktische Umsetzung. Der Treffpunkt vermittelt Spiel- und Bastelideen zum Einstieg. Die Verkündigung und Erzählung der biblischen Geschichte erfolgt im Knackpunkt. Im Doppelpunkt geht es um die Vertiefung des Themas auf unterschiedliche Art und Weise.
Außerdem enthält die Reihe noch Kreativangebote, mit denen die einzelnen Gebote von den Kindern auf kreative Art und Weise umgesetzt werden können.
Ideen, die dazu anregen, genau hinzusehen
Die Idee
Bei dieser Idee geht es darum, genau hinzusehen. Wir stellen mit verschiedenen Spielen und Aktionen vor, wie diese Idee Gestalt gewinnen kann. Die Vorschläge können einzeln oder en bloc eingesetzt werden. Und schon kann’s losgehen …
Begrüßung
Teil 1 – Hallihallo
Alle begrüßen sich ausgiebig mit Handschlag – dabei sollen die Kinder einander genau wahrnehmen. Wer trägt eine Jeans? Wer trägt eine Brille? Wer hat Sommersprossen? Diese Beobachtungen sind wichtig für das nächste Spiel.
Teil 2 – Der zweite Blick
Nach diesem sicherlich gesprächigen Start geht eine Freiwillige oder ein Freiwilliger vor die Tür. Die anderen Kinder erhalten die Aufgabe, an sich etwas zu verändern – und zwar offensichtlich,
z. B. den Pulli verkehrt herum anziehen oder ihn mit dem Nebensitzer zu tauschen … Die oder der Freiwillige kommt wieder in den Raum zurück. Welche Veränderung wird zuerst entdeckt?
Andachtsidee
„Der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an.” 1. Samuel 16,7
Gott schaut uns nicht nur ganz genau an – er sieht sogar in unser Herz hinein und weiß, wie es uns wirklich geht.
Spiele und Aktionen
Idee 1 – Wimmelbilder
Wimmelbilder zeigen viele Gegenstände auf einmal. In diesem Spiel geht es darum, aus der Fülle von Gegenständen Einzelheiten oder einzelne Gegenstände zu erspähen. Dazu werden
den Kindern Aufgaben zu einem Wimmelbild gestellt, die sie richtig beantworten sollen.
Variante 1: Die Kinder erhalten ein Wimmelbild und sollen verschiedene Dinge darauf entdecken, z. B.: Wie viele blaue Gegenstände sind auf dem Bild zu sehen?
Variante 2: Die Kinder haben zwei Minuten Zeit, um sich das Wimmelbild genau anzuschauen. Danach bekommen sie Fragen zum Bild gestellt, z. B.: Ist ein Nikolaus auf dem Bild zu sehen?
Variante 3: Die Kinder finden durch ihre Antworten den Weg zur nächsten Aufgabe.
Ein Beispiel: Die Kinder werden gefragt: Ist auf dem Wimmelbild ein Pferd zu sehen? Lautet die Antwort „ja”, führt sie ihr Weg nach rechts, lautet sie „nein”, gehen sie nach links. Ein zweites Beispiel: Die Kinder werden gefragt: Wieviele Tiere sind auf dem Wimmelbild zu sehen? Für jedes
entdeckte Tier gehen sie einen Schritt.
Mögliche Fragen zu den Bildvorschlägen:
Weihnachtsbilder
- Was stimmt hier nicht?
- Wie viele Weihnachtsmänner haben sich versteckt?
- Was ist hier alles zu sehen?
Spielzeugschublade
- Bild 1: Sind auf dem Bild nur Autos oder auch Flugzeuge abgebildet?
- Bild 2: Wie viele Tiere haben sich unter die Fahrzeuge gemischt?
- Denkt euch eine (lustige/ernste/fantastische …) Kurzgeschichte aus, in der alle abgebildeten Tiere vorkommen.
- Bild 3: Wie viele Pferde/Ponys sind abgebildet? Welche Farbe hat das T-Shirt des ab-gebildeten Pferdes? Wird ein Instrument auf dem Bild gezeigt?
Weitere Bild-Ideen
- Bälle: Welcher Ball steht nicht für eine Ballsportart? Abgebildet sind beispielsweise: (Mini-)Golfball, Tischtennisball, Tennisball, Fußball, Federball, Basketball, Handball, Rugby, aufblasbarer Wasserball (Richtig).
- Handys: Die Handys der Jungscharkinder werden fotografiert. Beim Fotografieren wird z. B. ein Festnetzmobilteil dazu gemogelt. Wer entdeckt den Fehler zuerst?
- Gegenstände fotografieren, die bei den Kindern gerade angesagt sind, und sich geeignete Fragen dazu ausdenken.
Idee 2 – Personenrätsel
Wer gehört nicht dazu? Wessen Partner fehlt? Wo ist der Fehler? Dazu werden biblische Personenpaare gemischt auf ein Blatt Papier geschrieben. Die Kinder sollen nun herausfinden, wer zu wem gehört, z. B
Wer nicht dazu gehört, ist von älteren Kindern leichter zu lösen. Schwerer wird es, wenn ein biblischer Name alleine steht (z. B. Zachäus). Welche biblische Person gehört zu ihm?
Mögliche Paare:
- Adam und Eva
- Kain und Abel
- Abraham und Sarah
- Jakob und Esau
- Isaak und Rebekka
- Josef und Benjamin
- David und Goliath
- David und Jonathan
- Petrus und Johannes
- Maria und Josef
- Maria und Martha
- Elisabeth und Zacharias
- …
Idee 3 – Fotosafari im Gemeindehaus
Die Kinder werden mit Digitalkameras ausgestattet bzw. benutzen Foto-Handys.
Sie bekommen auf einem Blatt Papier einige Aufgaben, z. B.: Fotografiert so viele Kreuze wie möglich (gezählt werden auch Fensterkreuze, Risse in Kreuzform usw.).
Variante 1: Die Kinder erhalten Hinweise auf einem Blatt Papier, die sie an verschiedene Stellen im Gemeindehaus führen, z. B.: Fotografiert die Schnitzerei an der Eingangstür, macht ein Foto, das alle Fenster auf der Rückseite des Gemeindehauses zeigt …
Variante 2: Die Mitarbeitenden fotografieren vor der Gruppenstunde verschiedene Orte und Details (manchmal auch nur Ausschnitte). Die Fotografien werden ausgedruckt und nach folgendem Schema verteilt:
Das erste Bild zeigt z. B. eine Schranktür im Gemeindesaal. Die Kinder haben nun die Aufgabe,
die Schranktür zu finden. Dort ist im Umkreis von einem Meter das nächste Foto versteckt, das sie weiter zum nächsten Ort führt. Am Ende des Spiels finden sie einen Schatz (z. B. ein Kuchen).
… das ist ein geniales Spiel! Auf ganz einfache Weise schärft es die Wahrnehmung. Es lässt uns Einzelheiten entdecken, die im alltäglichen Getriebe in der Regel unbeachtet bleiben.
„Ich sehe was, was du nicht siehst” – so könnte Gott bei sich gedacht haben, als Samuel glaubte, in Eliab den neuen König Israels zu sehen. Eliab – ein stattlicher Mann, der dem äußeren Anschein nach sicherlich allen Erwartungen an einen König entsprach. Aber Gott bremst den Propheten:
„Ein Mensch sieht, was vor Augen ist,
Gott aber sieht das Herz an.”
(1. Samuel 16,7b)
Nicht Eliab, sondern der jüngere, unscheinbare Bruder David wird zum König Israels gesalbt. Für Gott kommt es nicht darauf an, ob jemand stark, beliebt oder erfolgreich ist. Gott sieht ins Innere eines Menschen, und was er dort sieht, zählt mehr als alle Äußerlichkeiten.
„Ich sehe was, was du nicht siehst” kann auch ein Ansporn
für die Jugendarbeit sein. Macht euch gemeinsam mit den Kindern auf die Suche nach dem, was in ihnen steckt, und fördert ihre unentdeckten Stärken und Begabungen zutage!
Gegenstandsandacht zum Ewigkeitssonntag
Der letzte Sonntag im Kirchenjahr wird Ewigkeitssonntag oder auch Totensonntag genannt. In der evangelischen Kirche gedenken wir an diesem Tag den Menschen, die im vergangenen Jahr gestorben sind. Gleichzeitig erinnern wir uns aber auch daran, dass für uns mit dem Tod nicht alles endet. Als Christen haben wir die Hoffnung auf ein ewiges Leben nach dem Tod! In dieser interaktiven Andacht erfahren die Jugendlichen, wie die Bibel den Himmel beschreibt.
Einleitung
Als wäre in unseren Breitengraden der Monat November mit seinen kurzen Tagen, seinen kahlen Bäumen und dem oft grauen Wetter nicht schon trist genug. Es häufen sich in diesen Wochen auch noch einige Gedenktage, die die Laune zumindest auf den ersten Blick ziemlich niederdrücken können: Zwei Wochen vor dem 1. Advent findet der Volkstrauertag statt, bei dem in Deutschland den Opfern der beiden Weltkriege und des Nationalsozialismus gedacht wird. Nur eine Woche später, am letzten Sonntag des Kirchenjahres, begehen wir in der evangelischen Kirche den Ewigkeitssonntag, auch Totensonntag genannt. An diesem Tag denken wir in besonderer Weise an die Menschen, die im Laufe des vergangenen Kirchenjahres gestorben sind. Viele Menschen, die einen Angehörigen verloren haben, gehen an diesem Tag zum Gottesdienst oder auf den Friedhof. Gleichzeitig möchte der Ewigkeitssonntag uns aber auch daran erinnern, dass mit dem Tod nicht alles aus ist. Als Christen dürfen wir uns auf ein Leben nach dem Tod freuen. Ein Leben in Gottes Gegenwart! Damit wir schon heute einen kleinen Vorgeschmack auf den Himmel bekommen, malt uns die Bibel verschiedene Bilder des Himmels vor Augen. Jesus vergleicht den Himmel mit einem Haus, in dem es viele Wohnungen gibt, die er für uns vorbereitet (Joh 14,2–3). In den beiden letzten Kapiteln der Bibel (Offb 21 und 22) wird die neue Welt Gottes sehr detailliert, farbenfroh und hoffnungsvoll beschrieben. Ein positiver Kontrast zur dunklen Jahreszeit und ein ermutigendes Thema für Jugendliche zum Ende des Kirchenjahres mit der Möglichkeit, dass die Teilnehmenden sich selbst und ihre Vorstellungen vom Himmel einbringen. Im Anschluss werden mit Hilfe von verschiedenen Gegenständen Bibelverse aus Offenbarung 21 und 22 verbildlicht.
Hinweis: Wichtig ist, im Blick zu haben, ob es Teilnehmende gibt, die gerade mit dem Verlust eines Menschen zu kämpfen haben! Für sie kann die Andacht erfahrungsgemäß sehr tröstend sein, gleichzeitig kann die Auseinandersetzung mit dem Thema Tod eine Überforderung darstellen.
Vorbereitung
Material 1:
Plakate mit den 7 Bibelversen (s. u.), Gegenstände zu den Bibelversen (s. u.), Tuch oder Tischdecke, Weißes Papier oder Karteikarten, Buntstifte
Plakate anfertigen
Die folgenden sieben Bibelverse aus der Offenbarung werden sinngemäß auf einzelne Plakate geschrieben bzw. auf großen Blättern ausgedruckt:
„Gott selbst wird bei den Menschen wohnen und alle Tränen abtrocknen.
Offenbarung 21,3–4“
„Die Stadt war aus reinem Gold und die Mauer war geschmückt mit lauter Edelsteinen. Offenbarung 21,18 ff.“
„Die Stadt hatte zwölf Tore aus Perlen. Offenbarung 21,21“
„Man wird die Pracht und den Reichtum der Völker in die Stadt bringen. Offenbarung 21,26“
„Ein Strom geht aus vom Thron Gottes, und auf beiden Seiten des Stromes stehen Bäume des Lebens, die tragen zwölfmal Früchte, jeden Monat. Offenbarung 22,1–2“
„… und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Offenbarung 22,2“
„Und es wird keine Nacht mehr sein und sie brauchen kein Licht und keine Sonne, denn Gott der Herr, wird leuchten. Offenbarung 22,5“
Gegenstände suchen
Zu jedem der Bibelverse wird ein passender Gegenstand gesucht, der den Vers verbildlicht.
Für Offenbarung 21,3–4: z. B. Taschentücher.
Für Offenbarung 21,18 ff.: z. B. Edelsteine oder ein goldener Gegenstand (z. B. Goldschmuck).
Für Offenbarung 21,21: z. B. eine Perlenkette oder ein Glas mit einigen schönen Perlen.
Für Offenbarung 21,26: z. B. ein Weltatlas oder ein kleiner Globus.
Für Offenbarung 22,1–2: eine Frucht, z. B. Orange.
Für Offenbarung 22,2: Ein Blatt. Zugegeben, das ist im Monat November nicht ganz einfach zu bekommen, aber mit etwas Glück findet sich auf einem kahlen Baum noch ein letztes schönes Blatt! Zur Not muss die Zimmerpflanze herhalten oder evtl. findet sich ja beim Obsthändler eine Clementine mit Blatt ;-)).
Für Offenbarung 22,5: z. B. eine Kerze, ein Teelicht oder eine Taschenlampe.
- Die Gegenstände werden in der Mitte des Raumes / eines Tisches aufgebaut und mit dem Tuch verdeckt, bevor die Jugendlichen den Raum betreten.
- Weißes Papier bzw. Karteikarten und Buntstifte liegen bereit.
Durchführung
Ablauf
Zunächst werden die Jugendlichen gefragt, wie sie sich den Himmel vorstellen. Sie dürfen ihre Vorstellung entweder stichwortartig auf Karteikarten schreiben, oder ein Bild zu ihrer Vorstellung des Himmels malen. Anschließend stellen die Jugendlichen ihre Gedanken kurz vor. Die Karteikarten bzw. Bilder können z. B. an eine Pinnwand gepinnt werden und bleiben so für alle sichtbar.
Überleitung: „In der Bibel gibt es auch einige Beschreibungen des Himmels, damit wir ihn uns ein bisschen vorstellen können …“
Die Plakate mit den Bibelversen werden auf dem Tisch/Boden neben den unter der Decke versteckten Gegenständen ausgelegt. Die Jugendlichen dürfen nacheinander einen Gegenstand unter der Decke hervorholen und ihn dem passenden Bibelvers zuordnen. Das ist für sie selbstverständlich kein Problem, es geht vielmehr darum, dass der Himmel bildlich dargestellt wird. Das Tuch, unter dem die Gegenstände verborgen sind, macht das Geheimnisvolle des Himmels deutlich.
Wenn ein Jugendlicher einen Gegenstand dem entsprechenden Bibelvers zugeordnet hat, kann die Gruppe nach ihren Gedanken zu dem Vers gefragt werden und es kann ein kurzer Austausch stattfinden.
Anmerkung zu Offenbarung 21,26:
Besonders dieser Bibelvers wird von Theologen sehr unterschiedlich verstanden und ausgelegt. Einige Ausleger verstehen den Vers so, dass die verschiedenen Völker den Reichtum ihrer unterschiedlichen Kulturen in die neue Welt Gottes hineinbringen. So gesehen wäre der Himmel also ein sehr bunter und abwechslungsreicher Ort, in dem die Besonderheiten und die Individualität der Kulturen zum Ausdruck kommen würden.
Abschluss
Auch wenn besonders die Kapitel 21 und 22 der Offenbarung des Johannes ein sehr konkretes Bild vom Himmel beschreiben, ist es doch gleichzeitig wichtig, den Jugendlichen zu vermitteln, dass wir uns letzten Endes den Himmel mit unserer irdischen Vorstellungskraft in seiner vollen Realität nicht vorstellen können. Wir dürfen aber darauf vertrauen, dass Jesus, der uns jetzt schon liebevoll durch unser Leben begleitet, einen wundervollen Platz für uns vorbereitet, auf den wir uns freuen können!
Tipp: Im Anschluss an die Andacht könnte gemeinsam aus exotischen Früchten ein leckerer Smoothie oder ein Fruchtsalat hergestellt werden. Sozusagen als kleiner Vorgeschmack auf den Himmel und als Vitamin-Booster im November.
Spielbeschreibung
Das „A-Team“ (Name kann auch gerne angepasst werden) bekommt mal wieder eine wichtige Mission und nur gemeinsam als Team erfüllen sie die Aufgaben.
Als erstes sucht das Team Briefumschläge und die dazugehörigen Spielgegenstände auf einem Gelände bzw. notfalls auch in einem oder mehreren Räumen. Diese sind zur Sicherheit z. B. mit einem roten Punkt gekennzeichnet und sehr wichtig zur Erfüllung der Mission. Der Mitarbeitende geht mit der Gruppe. Am Ende der erfüllten Mission kann das Team noch mit einem gemeinsamen Preis (z. B. Essen) belohnt werden.
Die Aufgaben können entweder an verschiedenen Stationen auf einem Gelände oder notfalls auch in einem größeren Raum erfüllt werden.
Die Aufgaben für das A-Team
Umschlag 1
Aufgabe 1: Hallo liebes A-Team,
gut, dass ihr zusammengekommen seid, um uns zu helfen. Der Prinzessin von Wales sind wertvolle Goldperlen gestohlen worden. Ihr werdet nun beauftragt, sie zurückzuholen, bevor sie von dem großen Schurken Harald Selbiger weiterverkauft werden können.
Er wohnt auf einem großen Anwesen, das mit allerlei Tücken gesichert ist. Deswegen ist es wichtig, sich den Weg einzuprägen und das macht ihr gemeinsam im Team. Prägt euch ebenso alles ein, was ihr an Infos auf dem Blatt findet.
Aufgabe: An einem Holzstück ist ein Stift befestigt und ebenso viele Schnüre wie Kinder mitspielen. Jedes Kind hält ein Schnurende gespannt, so dass der Stift gerade in der Luft ist.
Ein Weg ist kurvig aufgezeichnet auf einem Flipchart-Papier. Die Breite des Weges sollte 10-15 cm betragen. Das Team fährt diesen Weg mit dem Stift nach. Wichtig ist, dass nicht über die Weglinien hinaus gemalt wird.
Info: Zu dieser Aufgabe gibt es im Dateianhang eine Erklärung.
Umschlag 2
Aufgabe 2: Nachdem ihr euch den Weg eingeprägt habt, kann es losgehen.
Als Erstes müsst ihr über den elektrischen Zaun des Anwesens kommen. Bei der kleinsten Berührung geht ein Alarm los. Also seid vorsichtig! Vielleicht gibt es Gegenstände, die euch dabei helfen.
Aufgabe: Eine Schnur ist auf Höhe von ca. 1 m gespannt (die Höhe der Körpergröße der Kinder anpassen, so dass die Schnur ca. auf Bauchnabelhöhe ist). Die Kinder klettern gemeinsam über diesen Zaun.
Mögliche Hilfsmittel: zwei Bretter
Mögliche Lösung: Zwei Kinder halten jeweils ein Brett, so dass die anderen über die Schnur klettern können.
Umschlag 3
Aufgabe 3: Erfolgreich den Zaun überwunden, kommt ihr nun zum Haus. Dieses ist wie eine Art Labyrinth aufgebaut. Ihr habt mögliche Kartenteile schon gefunden und müsst sie nun zusammensetzen, damit ihr den richtigen Weg zum Tresorraum findet.
Aufgabe: Die Puzzle-Teile richtig zusammensetzen.
Info: Zu dieser Aufgabe gibt es im Dateianhang eine Erklärung.
Umschlag 4
Aufgabe 4: Harald Selbiger liebt Rätsel über alles.
Deswegen hat er seinen Tresorcode in einem Rätsel versteckt, das die Kinder knacken müssen.
Dazu braucht man folgende Gegenstände: Geodreieck, Blatt mit Zeichnung, Plastikbecher,
Sprudelflasche, Mars-Schokoriegel. Wie geht das Rätsel?
Aufgabe: Die Kinder lösen das Rätsel und geben den Mitarbeitenden den richtigen Code.
Info: Zu dieser Aufgabe gibt es im Dateianhang eine Erklärung.
Umschlag 5
Aufgabe 5: Den Code müsst ihr nun möglichst schnell eingeben. Zahl für Zahl. Aber jeder muss daran beteiligt sein.
Das solltet ihr in einer Minute fehlerfrei hinbekommen. Übt kurz, damit das auch reibungslos und fehlerfrei funktioniert.
Aufgabe: In einem Seilkreis liegen verdeckt DIN-A5-Karten mit Nummern von 1 bis 20. Am Anfang dreht man die Nummern um und das Team prägt sie sich ein. Es wird im Team abgesprochen, wer sich merkt, wo welche Zahl liegt. Danach werden sie wieder vorsichtig umgedreht, ohne dass man die Zahlen kenntlich macht.
Dann darf jeweils nur ein Team-Mitglied in den Seilkreis und ein bis zwei Zahlen in der richtigen Reihenfolge von 1 bis 20 umdrehen.
Umschlag 6
Aufgabe 6: Der Tresor lässt sich öffnen. Das ist super. Nun müsst ihr mit den Goldperlen sehr vorsichtig sein, da die Fingerabdrücke von Harald Selbiger darauf zu finden sind. Diese dürfen nicht vernichtet werden, damit er für seine Taten noch zur Verantwortung gezogen werden kann. Deswegen dürfen sie nur mit Handschuhen angefasst werden.
Dummerweise wurde nach dem Öffnen des Tresors ein Laseralarm-System ausgelöst. Es reagiert auf menschliche Bewegung mit Goldmetallen und soll verhindern, dass die Goldperlen entwendet werden. Das heißt, ihr müsst eine Möglichkeit finden, mit dem vorhandenen Material etwas zu bauen, das nur die Perlen bewegt, und nicht Mensch und Perle zusammen.
Aufgabe: Das Team soll mit dem vorhandenen Material eine Art Rutsche bauen.
Umschlag 7
Aufgabe 7: Fast habt ihr es geschafft. Jetzt müsst ihr nur noch von dem Anwesen wegkommen. Ihr nehmt einen anderen Rückweg durch den Sumpf. Dazu habt ihr 15 DIN-A4-Kartonstücke.
Die sind stabil und helfen euch über den Sumpf. Ihr dürft aber nur auf den Kartons stehen und sie dürfen nie „leer“ sein, sonst lösen sie sich auf.
Aufgabe: Das Team muss eine Strecke von ca. 20 m gemeinsam überwinden, indem es sich mit den Karton-Stücken vorwärts bewegt.
Umschlag 8
Herzlichen Glückwunsch! Die Mission ist erfüllt. Die Perlen übernehmen wir ab hier und bringen sie zu ihrer rechtmäßigen Besitzerin, der Prinzessin von Wales.
Ihr seid ein richtig gutes Team! Danke für eure Hilfe.
Wir melden uns wieder, falls wir eure Hilfe erneut brauchen.
Besonderheiten:
Spiele sind für eine Gruppe von max. 15 Kindern gedacht
Dauer: 90 Minuten
Zielgruppe: 8-12 Jahre
Vorbereitungszeit: Aufwendig
Von Visionen, Tränen und der Frage nach dem Danach
1. Erklärungen zum Text
Es ist wie das spektakuläre Finale eines fesselnden Filmes. Am Ende bringt der Regisseur noch einmal alles an Effekten, Pathos und Heldenmut auf die Leinwand, um dem Zuschauer im Kinosessel den Atem zu rauben. Die Handlung des Blockbusters kommt zum krönenden Abschluss. Und wie es oft ist, wird dabei ein deftiger Ausblick auf einen möglichen zweiten Teil gegeben. So gesprochen wären die Verse der Offenbarung wohl der größte Cliffhanger der Filmgeschichte.
Johannes, der Autor des letzten biblischen Buches, gibt einen Ausblick auf Gottes himmlische Welt, die wir erwarten dürfen. Er wählt dazu mächtige und epische Bilder. Seine Erklärungen sind überschwänglich und schillernd. Es ist ein Blick über den Tellerrand der Welt, die Gott ihm zeigt. Das komplette Buch beschäftigt sich mit dieser prophetischen Zukunftsvision.
Aber am Ende des Lesens bleibt irgendwie ein seltsamer Geschmack übrig. Man möchte meinen, so gut er auch versucht seine Visionen zu beschreiben, es bleiben menschliche Worte und wahrscheinlich entsprechen sie nur annähernd dem, wie es wirklich sein wird.
Menschliche Sprache hat einfach Grenzen, aber Johannes gibt alles. So gewaltig ist die Vorstellung, dass Gott bei uns wohnen wird, quasi in direkter Nachbarschaft. Und jede Träne wird er trocknen, Trauer und Schmerz wird nicht mehr sein. Das Alte wird der Vergangenheit angehören (V.3.4). Diese Beschreibung wirkt auf uns, so positiv sie auch sein mag, unvorstellbar. Aber Gott meint es ernst. Sein Reich im Himmel wird alles je da gewesene in den Schatten stellen. So gesehen ist es dann auch irgendwie logisch, dass unser Kopfkino an seine Grenzen stößt. Könnten wir uns Gottes Größe und Macht vorstellen, wäre sie menschlich. Aber sie ist es nicht.
Damit wir sie verstehen, gibt er im Laufe des Neuen Testaments immer wieder Hinweise, wie die neue Welt aussehen wird. Jesus erzählt sogar ein Gleichnis, in dem er seinen Jüngern erklären will, was Gott da eigentlich plant. Das viel beschriebene Himmelreich ist ein schwer vorstellbares Land. Er vergleicht es in Matthäus 13 mit einem wertvollen Schatz, der im Acker versteckt ist (V.44) und mit einer kostbaren Perle (V.46), bei der es sich lohnt, alles dafür zu verkaufen.
Deutlich wird, dass die Perspektive Ewigkeit, die Jesus zu erklären und Johannes zu beschreiben versucht, kein bloßes Ziel ist. Vielmehr ist sie eine Lebenseinstellung, die hier und jetzt unsere ganze Leidenschaft benötigt. Und sie fängt dort an, wo wir Jesus mit all unserem Tun und Denken nachfolgen und sie wird dann vollendet, wenn Gott die Dinge so sein lässt, wie sie in Johannes’ Offenbarung beschrieben sind.
2. Bedeutung für heute
Das Buch der Offenbarung gibt einen imposanten Ausblick auf eine Welt, die wir noch nicht kennen. Unweigerlich führt das Spekulieren darüber auch zu den ganz persönlichen Fragen von Leben und Tod. Denn dieses vollendete Himmelreich soll kein theoretischer und traumhafter Ort bleiben, sondern unsere zukünftige Heimat. Dabei ist die Auseinandersetzung mit dem Tod keine einfache Sache.
Ein Gefühl, was es wohl am besten beschreibt, wenn ein lieber Mensch stirbt, ist Ohnmacht. Wir sind ohne Macht, diesen Verlust rückgängig zu machen, ohne jeglichen Einfluss, den Tod ungeschehen zu machen. Verlust kommt von Verlassen, ein Verlassen ohne zurückzukommen.
Wohin also mit den ungeklärten und offenen Fragen, mit der Trauer und der Wut? Wohin mit meinen eigenen Existenzängsten und der Frage nach Sinn und Sinnlosigkeit? Auf Beerdigungen werden oft die Verse aus der Offenbarung zitiert (Kap. 21). Sie sollen Trost spenden, indem sie sagen, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Gott ist der, der den Schmerz in seiner Hand hält und ihn gemeinsam mit uns, mit den Hinterbliebenen, aushält. Und doch wirken sie sehr abstrakt in einer solchen Situation, wo die Begrenztheit unseres Lebens so nahe kommt wie sonst nie. Wie sieht diese Welt aus? Wie wird sie sich anfühlen? Wer wird dort sein? Gott, wo fängt dein Himmel an, von dem du da redest?
Die Frage, wie wir mit dem Tod umgehen, ist eigentlich auch ziemlich stark eine Frage danach, wie wir mit dem Leben umgehen. Nicht selten wird Menschen am Ende ihres Lebens bewusst, was sie noch tun hätten können, was sie versäumt haben oder welche Brüche besonders verletzt haben. Für diese Fragen gibt es keine Lösung, denn Zeit wird nur nach vorn gelebt. Die Bibel lehrt uns, das Leben zu feiern und sich auf die Suche nach Gottes Geheimnissen – von dem der Himmel das größte ist – zu machen.
Die Perspektive Ewigkeit ist dabei kein bloßer Hoffnungsspender für die traurigen Momente, sie ist eine Lebenshaltung. Christen haben eine gigantische und reale Hoffnung an ihrer Seite, dass der Tod nicht die größere Macht besitzt und dieses Leben nicht im großen Dunkel endet. Deshalb beschreibt Jesus in den Gleichnissen vom Himmelreich (Mt 13) das Leben als eine Suche nach einem kostbaren Schatz bzw. einer kostbaren Perle. Und auf dieser Suche sind wir nicht missmutig und schlecht gelaunt unterwegs, sondern mit viel Vorfreude.
Wer mit Jesus an seiner Seite lebt, lebt mit dieser Hoffnung und wird immer mehr verstehen, wie Gott sich diese Welt wünscht und dass der Tod als Teil unseres Daseins dazugehört. Und wir können dabei lernen, damit umzugehen: Nicht verdrängend und verkrampft. Viel eher mitfühlend, ehrlich klagend, auch mal schweigen anstatt viel zu reden, eine einfache Umarmung wiegt manchmal mehr als der Versuch einer Erklärung. Wir lernen das eigentlich unerklärbare auszuhalten, ohne es zu verdrängen. Denn der Gott an unserer Seite ist geduldig, mitfühlend und unendlich mächtig.
3. Methodik für die Gruppe
3.1 Einstieg in die Thematik
Teilt euch in kleinere Gruppen auf (2–4 Personen). Jede Kleingruppe erhält den Auftrag, eine Collage aus Bildern zu erstellen. Dazu müssen schon im Vorfeld Zeitungen, Zeitschriften und Journale gesammelt werden, damit ein relativ großer Pool entsteht. Auftrag für die Collage ist die Frage: Wie sähe für dich eine perfekte Welt aus?
3.2 Darüber ins Gespräch kommen
Jetzt stellt sich jede Gruppe gegenseitig die Ergebnisse vor und erklärt die gestalteten Collagen. Wichtig dabei ist, dass diese Vorstellungsrunde zunächst unkommentiert abläuft und jede „Wunschwelt“ erst einmal für sich allein steht. Wenn alle fertig sind, startet eine offene Runde über die Collagen. Dabei können die Teilnehmenden sich gegenseitig Fragen zu bestimmten Bildern oder Elementen stellen und nachfragen, warum genau dies oder jenes in eine „perfekte“ Welt gehört.
3.3 Kurzer Impuls und Fragen zu dem Bibeltext Offenbarung 21,3.4
Wenn Gott eine Collage zu dieser Frage gestaltet hätte, würden diese Bilder darin vorkommen. Er würde in der direkten Nachbarschaft zu uns wohnen und jeder würde wissen, dass es ihn gibt und dass er Macht hat. Alle Tränen werden abgewischt werden und jeder Schmerz findet ein Ende. Wie sehr wünschen wir uns ein Leben ohne kaputte und zerstörte Beziehungen, ohne Sterben und Trauern, ohne Verletzungen? Das Leben ist voll davon und Gott kennt sie alle. Denn er hat sie auch durchgemacht, indem er seinen Sohn auf die Erde geschickt hat, der diese ganzen Leiden auch erlebt hat. Aber er verspricht, dass diese Welt ein Ende haben wird und wir uns darauf freuen dürfen. Denn in dieser Welt gibt es keinen Krieg und nichts mehr, was dazu führen könnte. Es ist die perfekte Welt, wie Gott sie sich vorstellt. Ohne Hass, Neid, Missgunst und vor allem ohne eins: den Tod. Auch wenn das für uns unvorstellbar ist, möchte er uns durch diese Vision vermitteln, dass er Herrscher über das Leben und den Tod ist, er ist gerecht, er sieht uns mit unseren persönlichen Zweifeln, Fragen, Ängsten.
Dieser Impuls soll einen Austausch im Plenum über den Bibeltext ermöglichen? Die Fragen dazu könnten folgende sein:
- Kannst du dir eine Welt ohne Krieg, Schmerz und Trauer vorstellen?
- Was kann es bedeuten, wenn Gott „bei uns wohnen wird“?
Am Ende des Austauschs sollte die Frage gestellt werden, ob man diesen Himmel, der in der Offenbarung beschrieben wird, heute schon sehen kann. Falls es im Gespräch passt, kann hier Jesu Gleichnis vom Himmelreich (Mt 13,44-46) zur Verdeutlichung herangezogen werden. Es macht klar, dass Gottes perfekte Welt kein Ort in der Zukunft ist, sondern jetzt schon beginnt. Und zwar dadurch, dass wir uns jetzt schon auf diese neue Welt freuen und auf die Suche danach machen.
Ist es möglich, dass wir Spuren dieser himmlischen Welt schon heute erkennen können? Was könnten diese sein?
3.4 Kleingruppen Brainstorming
In kleinen Gruppen kann dieser Frage noch einmal nachgegangen werden (kann gern auch die Collagen-Gruppe sein). Die Teilnehmenden sollen Ideen, Indizien oder „Hoffnungsschimmer“ beschreiben, an denen man erkennen kann, dass diese Welt jetzt schon in Stücken existiert. Beispiele: Jemand wird vor etwas Schlimmem bewahrt, ein guter Freund hat Trost gespendet, aus Streit wurde Versöhnung, usw. Diese Ideen können dann noch in Form von Text oder Bildern auf den Collagen ergänzt werden.
3.5 Abschluss im Plenum
Die Gruppen können den anderen noch die eindrücklichsten Ideen aus der Kleingruppe erzählen. Abschließend könnte ein Mitarbeiter als persönliches Zeugnis noch erzählen, was dieser Text bzw. die Aussicht auf den Himmel für ihn bedeutet. Dieser Input sollte folgende Zielfragen haben:
- Was heißt dieses Hoffen auf die Ewigkeit für mich persönlich?
- Inwiefern verändert das meine Sicht bzw. meinen Umgang mit Schmerz und Trauer heute, mitten in meinem Alltag?
Ein Gebet beendet die Gruppenstunde.
In meiner wilden Jugend war ein ziemlich angesagter Aufkleber der „Jesus Freaks“ im Umlauf: „Alles geht in Arsch – Jesus bleibt!“ Wir waren jung und standen drauf: provokant, cool und aussagekräftig. Bei den vielen aktuellen Ereignissen hat man manchmal das Gefühl, die Welt steht wirklich Kopf und bricht in sich zusammen. Es geht wirklich alles kaputt und den Bach runter. Sind wir eigentlich überhaupt irgendwo noch sicher? Doch eines kannst du dir sicher sein! Jesus bleibt! Wo hängt deine Welt an einem seidenen Faden? Es gibt Lebenssituationen, in denen man strauchelt! Dennoch darfst du wissen, dass du nie tiefer fällst als in Gottes Hand! Das bleibt! Wo hängen die Teens an einem seidenen Faden und drohen abzustürzen? Greife mit den Teens die nicht unbedingt leichten Themen der aktuellen TEC: auf und sorge für ein vertrauensvolles und seelsorgerliches Verhältnis, um echter Ansprechpartner und Gegenüber zu sein. Denn eins ist klar: Egal wie es deinen Teens geht: Jesus bleibt! Hängt Jesus auch an einem seidenen Faden? Jesus hing leider nie nur an einem seidenen Faden. Die großen Nägel, die seinen Körper durchbohrten, waren wohl deutlich schmerzvoller. Doch Jesus hängt zum Glück nicht mehr am Kreuz. Jesus lebt und bleibt!