Hier kommt die zweite Themenreihe der JUMAT 1/2021. Es geht um Jesu Leidensgeschichte im Johannesevangelium. In insgesamt 4 Lektionen erleben wir den Weg Jesu an’s Kreuz mit:
Lektion 10 Johannes 13,1-20 Was habe ich getan?
Lektion 11 Johannes 18,1-11 Wen sucht ihr?
Lektion 12 Johannes 18,28-40 Jesus, König der Juden?
Lektion 13 Johannes 19,16b-24 Warum?
Außerdem enthalten: Ein Familiengottesdienst zur Passionszeit.
Die einzelnen Lektionen sind nach dem gleichen Schema aufgebaut: Im ersten Teil sind exegetische Überlegungen, sowie Gedanken über Auswirkungen des Textes für mich und für die Kinder. Im zweiten Teil geht es um die praktische Umsetzung. Dabei werden mehrere Methoden und Möglichkeiten vorgestellt, wie die Umsetzung aussehen kann. Zur Vertiefung stehen jeweils 7 unterschiedliche Elemente zur Verfügung: Wiederholung, Gespräch, Merkvers, Gebet, Kreatives, Spielerisches und Rätselhaftes.
Das Ziel
Starter
Jesus ist der beste König, den es gibt. Er würde alles für dich tun, willst du das?
Checker
Jesus will der König in meinem Leben sein. Steh ich zu ihm, auch wenn es manchmal nicht so leicht ist?
Der Text an sich
Diese Textpassage ist mitten im Jesus-Verhörprozess drin. Davor hat Jesus zum letzten Mal mit allen seinen Jüngern gegessen, er hat ihnen erklärt was bald geschehen wird. Im Garten Gethsemane betet und ringt Jesus mit seinem Vater, er hat Todesängste, wird aber durch das Gebet gestärkt für die kommenden Stunden.
Einer seiner engsten Begleiter verrät ihn und Jesus wird festgenommen, nachdem er einem Soldaten noch ein abgeschnittenes Ohr geheilt hat.
Jesus wird vor den obersten Priester geführt, der die Entscheidungsmacht hatte. Bei diesem Verhör kommt nicht viel heraus, außer ein ins Gesicht geschlagener Jesus und eine aufgebrachte Menge. Bevor Jesus in den frühen Morgenstunden zu Pilatus gebracht wird, verleugnet einer seiner treuen Jünger ihn.
All dies passiert in einer Nacht ohne Schlaf; all diese Kämpfe, unangenehmen Situationen und Momente, in denen Jesus allein dasteht – zumindest ohne weltliche Unterstützung.
Dann wird Jesus zu Pilatus gebracht, der von den Römern eingesetzte Gouverneur für die Region von Jerusalem und Umgebung. Er hat die Entscheidungsgewalt.
Indem die Juden Jesus zu ihm bringen, ist klar, was sie eigentlich wollen – sie hätten einige Urteile selbst fällen dürfen, jedoch nicht das Todesurteil.
Auch hier ist Jesus nachher mit Pilatus alleine. Im Gespräch zwischen Pilatus und Jesus wird Pilatus durch die Fragen und Antworten Jesu herausgefordert. Jesus erklärt in Kürze und Klarheit, wer er ist und warum er auf dieser Welt ist – er will die Wahrheit bezeugen.
Theoretisch erkennt Pilatus teilweise „die Wahrheit“ – dass Jesus ein König und unschuldig ist. Aber diese Erkenntnis praktisch umzusetzen und den Juden zu verbieten, Jesus zu töten, traut sich Pilatus nicht. Er will keinen Aufstand in seinem Gebiet, er will keine aufgehetzten Juden. Also gibt er ihnen die Wahl – er zieht sich raus aus dem Dilemma und übernimmt keine Verantwortung.
Die Juden bekommen ihren Willen durchgesetzt. Sie nehmen alles in Kauf, sogar die Freilassung eines Verbrechers, um Jesus loszuwerden.
Der Text für mich
Pilatus fragt Jesus: Bist du der König der Juden? Was für eine faszinierende und verwirrende Antwort Jesus darauf gibt. Er ist ein König, aber was für ein König?
Jesus ist der König des Himmels und der König jedes Menschen, der die Wahrheit glauben will.
Dazu ist Jesus auf die Welt gekommen, um jedem die Möglichkeit zu geben, die Wahrheit (die einzige Wahrheit) zu erkennen.
Pilatus‘ Frage ist genial: „Wahrheit – was ist das?“
In dem Moment wusste Pilatus nicht, dass die Wahrheit vor ihm steht. Jesus. Wir haben die Bibel und somit auch vieles, was Jesus weitergegeben hat. Da sagt er auch einmal „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater, denn durch mich.“ Johannes 14, 6. Wenn wir Jesus kennenlernen, verstehen wir auch mehr und mehr, was wahr ist. Manchmal heißt das ganz praktische Veränderung in meinem Leben, die vielleicht auch mal schmerzhaft ist.
Darf Jesus in allen Bereichen Wahrheit reinsprechen – oder soll er doch lieber aus manchen Situationen „verschwinden“, nicht so viel Aufruhr machen?
Der Text für dich
Starter
Wie Pilatus lernen die Kids Jesus gerade erst kennen. Sie haben vielleicht schon vieles von ihm gehört, können das alles aber noch nicht wirklich einschätzen, oder was er mit ihrem Leben zu tun hat.
Die Kinder kennen es wahrscheinlich alle selbst, dass sie manchmal allein vor anderen dastehen. Die anderen lachen sie aus, erzählen „Lügen“ über sie oder lachen über „Wahrheiten“ aus dem Leben der Kinder, die diese dann als negativ wahrnehmen.
Genauso bei Jesus. Er steht allein da, gefühlt hält niemand zu ihm. Und doch ist er mutig und weiß, dass er nicht allein ist. Denn er hat ja ein Königreich in einer „anderen Welt“. So sind wir und die Kinder auch nie allein und dürfen in Momenten, in denen wir ausgelacht werden / nicht dazugehören, wissen, dass Jesus da ist.
Checker
Die Kinder haben schon oft von der Kreuzigung Jesu gehört. Wie er verhört, ausgepeitscht, geschlagen, verurteilt und hingerichtet wurde. Die Kinder können herausgefordert werden, sich zu überlegen, wie die Situation aus der Sicht der Juden war, die Jesus eigentlich gut fanden. Ein paar von ihnen standen vielleicht auch in der Menge vor dem Palast. Was haben sie wohl gesagt oder nicht gesagt? Sie wussten, dass Jesus nichts Schlimmes tat und nur das Beste wollte. Dass das, was er sagte oder tat, wahr und richtig war. Und jetzt sollte ihr bester Freund, ihr Begleiter, Helfer, sterben und sie konnten nichts dagegen tun. Das fühlt sich nicht so gut an. Wie geht es den Kids, wenn sie zu Jesus stehen wollen vor anderen? Wie geht es ihnen, wenn sie für andere einstehen wollen und es nicht können? Trotzdem sie ermutigen, es weiter zu tun – was wir auf jeden Fall tun können, ist, füreinander beten.
Der Text erlebt
Hinführung
Idee 1
Fragen in der Gruppe stellen:
- Wie stellt ihr euch einen König vor? Was muss der alles können / wie muss er aussehen?
- Wenn er der König ist, kennen die Leute vor Ort ihn dann auch?
Idee 2
Wahr oder Falsch – Spiel
- Die Teilnehmer werden in zwei Gruppen geteilt
- Die Gruppen stellen sich gegenüber mit ca. 2-3m Abstand auf.
- Die Teilnehmer der Gruppen werden durchnummeriert. So, dass es in jeder Gruppe eine 1, eine 2, eine 3 usw. gibt. Die Kinder mit den gleichen Zahlen stehen sich gegenüber.
- Am Ende des Raumes wird ein Stuhl mit dem Zettel „Wahr“ hingestellt, am anderen Ende steht der zweite Stuhl mit dem Zettel „Falsch“
- Der Spielleiter liest eine Aussage vor, ruft eine der vorhandenen Zahlen und die zwei Kinder müssen zu dem Stuhl rennen, je nachdem, ob sie glauben, dass die Antwort „Wahr“ oder „Falsch“ ist.
Mögliche Aussagen:
Eine Raupe hat genauso viele Muskeln, wie ein Mensch
FALSCH – sie hat etwa 3x so viel Muskeln
Krokodile können ihre Zunge nicht herausstrecken
WAHR
Raupen werden später einmal Fliegen
FALSCH
Die Bibel wurde von vielen Menschen mitgeschrieben
WAHR
Die Lieblingsfarbe von _______(Name des Mitarbeiters) ist _____
Die Antwort solltest du dann wissen 😉
Verkündigung
Mitmachtheater
- Die Teilnehmer der Gruppenstunde bekommen verschiedene Rollen und müssen diese nachspielen
- Dies ist mit Verkleidung natürlich witziger
Erzähler: Eine große Menschenmenge steht vor den Toren des Palastes. Und Jesus, er steht etwas abseits, geschlagen, gebunden und von einem Soldaten bewacht. Die Menge schreit, während Jesus ganz ruhig ist.
Menge: Pilatus, Pilatus, komm heraus. Pilatus
Erzähler: Pilatus kommt aus seinem Haus raus und fragt
Pilatus: Mit was beschuldigt ihr diesen Mann? Was hat er denn getan?
Aus der Menge: Wir würden ihn doch nicht extra zu dir bringen, wenn er nicht einer Sache wirklich schuldig wäre.
Erzähler: Pilatus ist davon nicht überzeugt und sagt einfach
Pilatus: Verurteilt ihr ihn doch. Ihr habt auch ein jüdisches Gericht und könnt Urteile aussprechen. Es ist eure Sache, nehmt ihn wieder mit.
Erzähler: Sofort antwortet ein wichtiger jüdischer Entscheidungsträger
Pharisäer: Aber wir dürfen in unserem Gericht niemanden zum Tode verurteilen, das dürft hier nur ihr Römer.
Erzähler: Jesus stand die ganze Zeit stillschweigend an seinem Platz. Hörte zwar alles, sagte aber nichts dazu.Pilatus war das alles zu viel, was sollte er denn jetzt machen? Die Juden wollten doch nur, dass er, Pilatus, ihre Meinung bestätigte und diesen Mann zum Tode verurteilte.
Pilatus ging nochmal rein, lies alle draußen stehen und rief Jesus zu sich. Der wurde von einem der Soldaten reingeführt.
Pilatus schaute Jesus genau an und fragte dann
Pilatus: Bist du der König der Juden?
Jesus: Wie kommst du auf diese Frage? Hast du dir diese selbst gestellt oder haben andere dir diese Frage eingetrichtert?
Pilatus: Bin ich etwa ein Jude, dass ich eine Antwort darauf habe, wer der König der Juden ist? Dein eigenes Volk, die führenden Männer deines Volkes haben dich zu mir gebracht. Irgendwas musst du getan haben. Aber was?
Jesus: Ja, ich bin ein König. Aber nicht nur der König der Juden, denn mein Königreich ist nicht von dieser Welt.
Pilatus verwirrt: Dann bist du also doch ein König!?
Jesus gelassen: Genau richtig. Ich bin ein König. Darum bin ich hier auf diese Welt gekommen, um für die Wahrheit in dieser Welt einzutreten. Dass alle Menschen die Chance haben, zu verstehen, was die Wahrheit ist. Weißt du, Pilatus, jeder der die Wahrheit wirklich will und wenigstens etwas davon verstehen möchte, der hört auf das, was ich sage.
Pilatus: Wahrheit? Was ist denn Wahrheit?
Erzähler: Nach diesem kurzen Gespräch mit Jesus war Pilatus noch etwas verwirrt, sah aber keine Schuld bei Jesus.
Also ging er raus. Er dachte, bei dem Angebot, dass ich den Juden jetzt mache, werden sie sicher Jesus wählen, dann muss ich ihn nicht verurteilen. So kann ich mich leicht aus dieser Situation rausmogeln.
Pilatus: Liebe Volksmenge, ich halte Jesus für unschuldig. Aber es soll eure Entscheidung sein. Bald ist das Passahfest und bei diesem Fest ist es die Tradition, dass ich euch einen Gefangenen wieder freigebe. Wollt ihr, dass ich euch Jesus, den König der Juden, dieses Mal freilasse?
Volksmenge: Nein, nein, nein, nein, nein….Wir wollen Barabbas, wir wollen Barabbas. …
Erzähler: Aber Barabbas war doch ein Verbrecher.
Mitarbeiter: Was hat euch in der Rolle Spaß gemacht? Was fandet ihr nicht so toll? Habt ihr euch wohlgefühlt in eurer Rolle?
Die andere Idee
Marker-Erzählung
- Die Textmarker bekommen ein Gesicht auf den Deckel gemalt oder darauf geklebt.
Das hier sind Markus und Justus (zwei kleine Marker), sie sind zwei römische Kinder, die in dem Palast von Pilatus (ein großer Marker), dem römischen Gouverneur in Jerusalem, leben. Sie sehen, wie eine große Menschenmenge (Stiftebox) zum Tor kommt.
Da fragt Justus: „Hey Markus, was ist denn heute eigentlich los? So viel ist doch sonst nicht kurz vor dem Passahfest hier los, oder?“
Markus ist auch etwas verwundert „Ja ich versteh es auch nicht so richtig, aber sieh mal hin, da drüben ist ein gefesselter Mann (auch großer Marker), den sie mit hierherschleppen. Es könnte spannend werden. Komm, wir gehen mal etwas näher hin.“
Die Jungs gehen in die Richtung der Volksmenge, bleiben dann aber in einer gewissen Entfernung stehen. Da kommt Pilatus – der Chef – raus und redet mit der Menge. Die Jungs hören genau hin, haben aber immer diesen Mann an der Seite im Blick.
Die Jungs verstehen nicht alles, außer, dass die Juden meinen, sie würden niemanden ohne Grund zu Pilatus bringen und, dass sie bei sich niemanden zum Tode verurteilen dürfen.
Markus flüstert zu Justus: „Hast du das gehört? Die wollen den Mann umbringen.“ „Ja, der muss was richtig Schlimmes gemacht haben, wenn sie ihn töten wollen. Und es stimmt, die Juden dürfen in ihrem Gericht niemanden zum Tode verurteilen, dass dürfen nur wir Römer. Ich bin gespannt, was Pilatus macht.“
Markus sagt „Schau mal, Pilatus geht rein und lässt diesen Mann, alle nennen ihn Jesus, zu sich bringen. Komm, wir gehen hinterher.“ Markus läuft schon los, aber Justus will nicht so richtig. „Oh Markus, du hast mich schon in manche Schwierigkeiten gebracht, aber okay.“
Die Jungs hören, wie Pilatus mit Jesus redet: „Bist du der König der Juden?“ Justus denkt: „Ein jüdischer König wäre für uns Römer nicht gut, die warten schon lange auf ihren ,Retter‘, der sie von uns Römern befreien soll. Aber der sieht nicht wirklich wie ein König aus…“.
Zum ersten Mal hören die Jungs die Stimme dieses Mannes. Er hört sich überhaupt nicht ängstlich an, sondern ruhig, mutig und voller Sicherheit. Wie kann das sein, bei einem Verhör?
Jesus sagt: „Ja ich bin ein König, aber mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Ich bin auf diese Welt gekommen, um allen die Wahrheit zu zeigen. Jeder soll mitbekommen dürfen, was wahr ist.“
Markus ist verwirrt, er schleicht sich zu Justus… „Hast du das gehört? Was bedeutet das denn, ein König von einer anderen Welt?“ „Pssssst, ich will hören, wie es weiter geht“
Pilatus schaut Jesus direkt in die Augen und fragt „Wahrheit, was ist Wahrheit eigentlich?“, dann läuft Pilatus zur Tür. Die Jungs müssen schauen, dass sie wegkommen und nicht entdeckt werden.
Justus fragt: „Markus, hat Pilatus wirklich jetzt schon eine Entscheidung getroffen? Ich sehe überhaupt keinen Grund, diesen Jesus umzubringen?“
Markus zuckt nur mit den Schultern, er weiß auch nicht so recht. Jetzt fängt Pilatus an zu reden: „Ich sehe keine Schuld bei diesem Mann.“ Markus lächelt, das hätte er auch gesagt. Dann redet Pilatus weiter „Jedes Jahr gebe ich euch zum Passahfest einen Gefangenen frei. Wollt ihr dieses Jahr diesen ,Jesus, den König der Juden‘ freihaben?“
Justus lächelt schon zu Markus rüber: „Pilatus ist schon schlau, er hat einen Weg gefunden, wie er Jesus freilassen kann.“ Markus meint: „Ja das war echt gut, dann gibt es schon keinen Aufstand, weil sie nicht einig mit seiner Meinung sind.“
Aber die Volksmenge schreit: „Nein, nein, wir wollen Barabbas. Wir wollen Barabbas wieder frei haben.“
Justus ist schockiert. Wie konnte das sein? Justus schaut nochmal in die Menge, ein paar wenige schreien nicht mit, aber die meisten sind wirklich gegen diesen Jesus.
Er versteht nichts mehr, traurig läuft er weg. Markus läuft ihm schweigend hinterher. So hatten sie sich diesen Tag nicht vorgestellt.
Der Text gelebt
Wiederholung
Quiz:
Wer brachte Jesus zu Pilatus? Das jüdische Volk
Was wollten sie, dass Pilatus tut? Jesus zum Tode verurteilen
Zu welchem Volk gehörte Pilatus? Römer
Was fragte Pilatus Jesus? Ob er der König der Juden ist?
Ist Jesus ein König? Ja
Von wo ist Jesus der König? Von allem 😊
Warum ist Jesus auf die Welt gekommen? Um die Wahrheit zu bringen
Warum gab Pilatus einen Gefangenen frei?Es war Tradition, dass ein jüdischer Gefangener zum Passahfest freigelassen wird.
- Krone
- Eine Krone wird aufgezeichnet und ausgeschnitten
- Auf diese Krone wird geschrieben, was Jesus als König macht, von wo / wem er König ist und warum Jesus auf die Erde kam.
Gespräch
Fokus auf: Was für ein König ist Jesus?
Pilatus musste eine ziemlich schwere Entscheidung treffen. Sollte er dem Volk glauben, was sie über Jesus sagten, oder sollte er seinem eigenen Instinkt glauben?
Jesus selbst hat sich nie verteidigt, sondern gesagt, dass er immer für die Wahrheit eintreten wird und dass er ein König ist. Aber nicht ein König von dieser Welt… Was meint ihr: Was könnte das bedeuten? Von wo ist Jesus dann ein König?
Jesus ist Gott und somit König der ganzen Welt. Er ist auch der König im Himmel und er möchte auch der König, der Herrscher, in deinem und meinem Leben sein. Er ist der beste König überhaupt. Er meint es wirklich gut mit dir und mir. Er möchte gerne immer bei uns sein und uns verteidigen.
Willst du, dass Jesus dein König ist?
Fokus auf: Was ist Wahrheit?
Fällt es euch leicht, immer die Wahrheit zu sagen? Ist es manchmal einfacher, zu lügen oder sowas Halbwahres zu sagen?
Wie ist es für dich, zu Jesus zu stehen, wenn in der Schule oder bei Freunden mal über Gott, die Jungschar, Jesus oder die Bibel geredet wird?
Ist es da leicht die Wahrheit zu sagen und zu Jesus zu stehen oder eher schwer?
Das Schöne ist, Jesus steht immer zu uns. Deswegen hat er sich auch von den Juden auslachen und von Pilatus verurteilen lassen. Weil er auch sie so liebhatte und wusste, dass sein Tod der einzige Weg ist, damit sie die Wahrheit ein wenig verstehen. Hört sich verrückt an, aber dazu mehr in der nächsten Jungschar.
Merkvers
Jesus sagt von sich selbst: „Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch mich.“ (Johannes 14,6 Luther)
Wenn wir Jesus kennenlernen, verstehen wir besser, was Wahrheit ist.
Methode:
- Der Bibelvers wird auf ein großes Plakat geschrieben und dreimal mit den Kindern gemeinsam gelesen.
- Dann werden passende Bilder über die Worte: Weg, Wahrheit (z. B. eine Waage, Ausrufezeichen, Richterhammer, …), Leben (z. B. Herz, Frequenzen, Blüte, (Tier)Baby…), niemand, Vater und mich (z. B. Finger, der auf sich zeigt…) gehängt. Diese Bilder werden kurz erklärt, warum sie zu diesem Wort passen. Danach wird der Vers noch ein paarmal wiederholt.
Gebet
Stellt euch als komplette Gruppe in einem Huddel (Teamkreis) auf. In die Mitte könnt ihr die Krone legen, als Zeichen dafür, dass Jesus der König in eurer Mitte ist.
- Wer will, darf laut oder leise einen Satz beten
- Bevor „Amen“ gesagt wird, dankt ein Mitarbeiter, dass Jesus unser König sein will.
- Nach dem Amen kann in Siegesjubel übergegangen werden 😊
Kreatives
Blech-Kronen
(Material: Blechdosen, Papier, Stifte, Eddings, Blechschere, Farbe, Pinsel, Heißkleber, Perlen)
- Nur mit älteren Kindern basten
- In die Blechkronen können Stifte, Pflanzen, Süßes usw. gestellt werden
Einfach diesen Links folgen:
- https://www.swr.de/buffet/kreativ/so-geht-s-kronen-aus-blechdosen/-/id=257204/did=21576126/nid=257204/4ptuki/index.html
- https://www.youtube.com/watch?v=XOKe2J_oAWA
- https://www.swr.de/buffet/kreativ/so-geht-s-kronen-aus-blechdosen/-/id=257204/did=21576126/nid=257204/4ptuki/index.html
- https://www.youtube.com/watch?v=XOKe2J_oAWA
Kronen aus Klopapierrollen
(Material: Klopapierrollen, Scheren, Stifte, Farbe, Material zum Verzieren, Kleber)
Anleitung:
Jeder bekommt eine Klopapierrolle und zeichnet sich am oberen Rand die Zacken einer Krone ein.
Diese werden dann mit einer Schere ausgeschnitten. Danach kann die Klopapierrolle mit Farben, Sticker, Perlen usw. verschönert werden.
Darauf können die Kinder die Frage scheiben „Wer ist dein König?“.
Die Klorollen-Krone kann dann als Stifthalter oder ähnliches verwendet werden.
Spielerisches
Bodyguard (benötigt einen Ball)
Alle stehen im Kreis. 2 TN sind im Kreis: 1x der König & 1x der Bodyguard. Die Kids außerhalb versuchen, den König abzuwerfen. Der Bodyguard verhindert das. Wurde der König getroffen, wird der Bodyguard zum König und der Werfer zum Bodyguard.
Eigentlich wird ein König ja bewacht und gut auf ihn aufgepasst. Versucht mal, eure „Könige“ zu schützen und für sie einzustehen
Jesus ist ein etwas anderer König, er braucht es nicht, dass wir ihn beschützen, er steht für uns ein. Er nimmt alles auf sich, um uns zu beschützen.
Rätselhaftes
Ein Buchstaben-Rätsel ist beigefügt, in dem Wörter zu finden sind, die mit der heutigen Geschichte zu tun haben.
(T)Extras
Spiele
König sagt
Einer ist der König, der das Kommando gibt (angelehnt an Kommando-Bimberle):
„Der König sagt, umdrehen“ – alle drehen sich um; „Der König sagt, hüpfen“ alle hüpfen… aber die anderen dürfen der Anweisung nur folgen, wenn der König zu Beginn des Satzes auch „Der König sagt“ sagt. Sonst müssen die anderen die vorherige Aktion wiederholen. Wer es falsch macht, fliegt raus. Die Aktionen können sehr kreativ werden.
Ziel des Königs ist es, die anderen aus dem Spiel zu bekommen.
Die Mehrheit gewinnt
(Material: Markierung für die Mittellinie, viele leichte Gegenstände)
Dieses Spiel kann drinnen (in einem großen Raum) oder draußen gespielt werden.
Das Spielfeld wird in zwei Bereiche geteilt (die Mittellinie wird gekennzeichnet), die Kinder in zwei Gruppen.
Auf jede Spielseite werden etwa gleich viele Gegenstände (Pappdeckel, Becher, Papierkronen…) gelegt.
Ziel des Spieles ist es, nach Ablauf der Zeit (erstmal 10 min, kann wesentlich länger gespielt werden) am meisten Gegenstände auf seiner Spielseite zu haben.
Solange ein Spieler auf seiner Seite ist, kann er nicht gefangen werden, ist er aber auf der gegnerischen Seite und wird gefangen, muss er in die Hocke gehen und dort an dem Platz warten, bis er von einem seiner Team-Kollegen befreit wird.
Die Gegenstände auf der eigenen Seite dürfen nicht verschoben werden.
Wenn man gefangen wird und einen Gegenstand gerade in der Hand hält, muss dieser fallengelassen werden. Die Gegenstände dürfen nicht zur eigenen Seite geworfen werden und man darf immer nur einen Gegenstand mitnehmen.
=> Die Juden wollten so viele Leute wie möglich, vor allem aber Pilatus, von ihrer Meinung (ihrer Sicht / Seite) überzeugen. Haben alles dafür gemacht.
Weiterführende Hinweise, zum Beispiel Internetadressen
- Film-Ausschnitt (nur für Ältere) https://www.youtube.com/watch?v=fJjT5mbw9Gg&t=103s
- Kinderlied: https://www.youtube.com/watch?v=4wrMi9KboAM
Das Kleingruppen-Material beinhaltet: Hintergrundinfos zum Text, einen Bezug zur Zielgruppe und Ideen zur Gestaltung der Kleingruppenzeit.
Die Kleingruppen laufen nach einem Rotationsprinzip. Jeder Kleingruppe wird von mind. einem Mitarbeitenden begleitet und läuft von Station zu Station. Durch ein Signal vom Zeitwächter wird den Gruppen signalisiert, dass sie zur nächsten Station aufbrechen. Je ein weiterer Mitarbeitender ist bei einer der 5 Stationen die je 7 Minuten dauern:
- Gespräch inkl. Fragen
- Spiel
- Kreatives
- Bibellesen und Gebet
- Extra/Spezial
Gedanken und Hintergrundinformationen zum Text
In dem Kapitel zuvor hat Jona in Ninive die Botschaft von Gott übermittelt, dass er die Stadt in 40 Tage vernichten wird, wenn sie nicht zu Gott kommen.
Hier gibt Gott der Stadt Ninive eine zweite Chance, sich zu bessern, denn die Bewohner von Ninive beten Götzen an und verhalten sich nicht im Sinne von Gott. Und zu Jonas Erstaunen bekennen die Bewohner ihre Fehler und tun Buße. Gott freut sich darüber und verschont die Stadt vom Unheil.
Jona gönnt den Menschen die Gnade Gottes überhaupt nicht. Sie haben es in seinen Augen überhaupt nicht verdient. Er geht grimmig auf einen Hügel, um zu beobachten was mit der Stadt passiert.
Dort schenkt Gott Jona einen Baum (einen Rizinus). Der Baum soll Jona als ein bildlicher Vergleich dienen. Dabei steht der Baum für die Stadt Ninive. Gott freut sich über die Stadt Ninive, als sie zu ihm zurückgekommen sind, so wie sich Jona über den Baum (Rizinus) gefreut hat. Aber ohne die Gnade Gottes wäre die Stadt zerstört, so wie der Rizinus für Jona nicht mehr da ist. Dies soll Jona zeigen, der nicht wirklich gnädig zu den Mensch in der Stadt ist, wie toll Gottes Gnade doch ist.
Ob Jona etwas aus der Geschichte gelernt hat, steht nicht in der Bibel.
Zielgedanke: Gott schenkt Gnade, er gibt jedem eine 2. Chance
Bezug zur Altersgruppe
Für die Kinder wird der Fokus auf die Gnade als Geschenk und auf die Zweite Chance gelegt, die die Stadt Ninive erfährt. Es soll klar werden, dass Gnade ein Geschenk ist, welches sich die Bewohner nicht verdienen können, sondern geschenkt bekommen. Zusätzlich kann man daraus lernen, dass Gott sich wünscht, dass wir zu anderen gnädig sind und ihnen auch die Gnade Gottes gönnen.
Kleingruppen Übersicht
- Station 1: Kreatives
- Station 2: Spezial
- Station 3: Bibellesen und Gebet
- Station 4: Spiel
- Station 5: Gespräch
Hinweis: Die Kleingruppen laufen nach dem Rotationsprinzip. Jeder Kleingruppe wird von einem Mitarbeitenden begleitet und läuft von Station zu Station. Gruppe 1 – startet bei Station 1, Gruppe 2 – bei Station 2 usw. Durch ein Signal vom Zeitwächter (einem Mitarbeitenden) wird den Gruppen nach 7 Minuten signalisiert, dass sie zur nächsten Station aufbrechen.
Station 1: Kreatives „Geschenkbox aus Streichholzschachteln“
- Die Kinder erhalten jeweils eine Streichholzschachtel,
die sie verzieren können. Sie haben die Möglichkeit diese mit Stickern zu bekleben,
mit bunten Papier zu umhüllen oder bei weißen Schachteln, diese anzumalen.
Dazu muss das bunte Papier auf die passende Größe geschnitten werden. Die Sticker können auf dem Tisch verteilt werden, damit man sie gut einsehen kann.
Am Ende sollen sie auf den Boden der Innenschachtel das Wort Gnade schreiben oder ein Herz malen. Die Schachtel wird geschlossen und mit einem Geschenkband umwickelt und damit verschlossen.
Tipp für kleinere Kinder: Kleinere Kinder werden wahrscheinlich Hilfe beim Zubinden der Schachteln brauchen. Damit die Zeit besser genutzt werden kann, sollte man das bunte Papier schon vorher in der Vorbereitung auf die passende Größe schneiden, wie auch das Geschenkband. Vor allem den Kindern der 1./2. Klasse hilft die Vorbereitung zu einem tollen Ergebnis.


Material:
- Streichholzschachteln (bevorzugte Größe: normal kleine)
- Buntes Papier (evtl. passend zu geschnitten) für die Grundfarbe der Schachteln
- Klebestifte (um das Papier auf der Schachtel zu befestigen)
- Scheren (zum zurecht schneiden des bunten Papiers)
- Bunte Stifte (zum Schreiben und Malen auf der Innenschachtel oder auch zum verzieren)
- Sticker (zum zusätzlichen gestalten)
- schmales Geschenkband (zum Verschließen der Schachtel)
Station 2: Spezial „Der Fleck muss weg!“
Anhand eines schmutzigen Stück Stoffs wird den Kindern gezeigt, dass Gnade ein Geschenk Gottes ist und diese nicht verdient werden kann. Mit Gallseife wird der Fleck entfernt und damit Gottes Gnade verdeutlicht.
Vorbereitung: Tische stellen, Putzmittel auf den Tisch platzieren und Decke darüber platzieren, Kaffee auf das Stück weißen Stoff platzieren.
Durchführung: Die Kinder kommen herein und sollen sich um einen Tisch stellen, der sich in der Mitte des Raumes befindet. Der Mitarbeiter holt ein Stück weißen Stoff her, das einen Kaffeefleck hat, hervor. Seht Euch mal dieses Stück Stoff an! Was fällt euch auf? (Der Fleck)
Dieser Fleck steht für das, was wie die Stadt Ninive war. Wie war die Stadt bevor Jona kam? (Böse)
Der Fleck ist all das Böse und Schlechte, das die Bewohner getan haben.
Was meinte Jona denn wie man wieder gut werden kann? (Indem man sich anstrengt, Gutes tut und man sich Gottes Gnade verdient)
Also müssen wir uns anstrengen um das Schlechte zu entfernen.
Dazu sind hier verschiedene Mittel, die man nutzen könnte, um den Fleck sauber zu machen.
Jedes Kind darf sich ein Mittel aussuchen, das zuvor auf einen anderen Tisch unter einer Decke platziert war. Auf dem Tisch steht: Buttermilch, Sonnenmilch, Öl, Rasierschaum, Zahnpasta, Schwamm. Die Kinder sollen hintereinander die einzelnen Möglichkeiten in einem kleinen Bereich des Stoffes ausprobieren. (Keine dieser Mittel werden den Fleck entfernen.)
Und funktioniert es? Wird es sauber?
Nachdem alle Kinder einmal ihr Mittel am Fleck ausprobiert haben geht es weiter:
Egal wie sehr wir uns anstrengen und bemühen der Fleck geht nicht weg! Aber was hat Gott zu Jona gesagt, warum die Bewohner von Ninive noch leben? (Gott hat den Bewohner Gnade geschenkt, sie mussten es nicht verdienen) Gott schenkt ihnen Gnade, da können sie sich und wir selber uns noch so anstrengen, den Fleck (das Schlechte) in uns zu entfernen. Das Einzige, das wir müssen, ist es das Geschenk einfach anzunehmen.
Eine Gallseife wird aus einer Geschenkbox geholt. Und wenn wir dieses Geschenk annehmen dann verschwindet auch der Fleck und auch das Schlechte und das Böse, das uns von Gott trennt.
Mitarbeiter feuchtet den Fleck mit Wasser an und rubbelt mit der Gallseife den Fleck weg und dieser wird sauber. (Experiment endet hier) Wichtiger Hinweis: Nicht zu viel Wasser verwenden!
Falls Zeit übrig ist können noch Fragen gestellt werden…
Material:
- Ein
Ort mit Malunterlagen oder eine Küche (es könnte nass und dreckig werden) - Stück
weißer Stoff (auf dem wird der Kaffeefleck platziert) - gekochter
Kaffee ohne Milch, egal ob er schon abgekühlt ist (Dieser wird mit einem Löffel
auf das Stück Stoff platziert.) - ein
Löffel (für den Kaffee zum dosieren) - Verschiedene
Putzmittel wie: Buttermilch, Öl, Sonnenmilch, Rasierschaum, Zahnpasta, Schwamm (zum
Ausprobieren für die Kinder) - Eine
Decke (um die Putzmittel erstmal verdeckt zu halten, damit der Fokus auf die
Mitte liegt und den Mitarbeiter)
Station 3: Bibellesen „Gummibärchen verdienen“
Vorbereitung:
- Bibel mit Post-Its bearbeiten (dafür auf Bibelserver.com Suchbegriff ,,Gnade” eingeben und von den Ergebnissen einige mit einem Marker und einem Post-It markieren in der Bibel markieren)
- Die Stelle Römer 10, 6 mit einem herausstechenden Post-It markieren
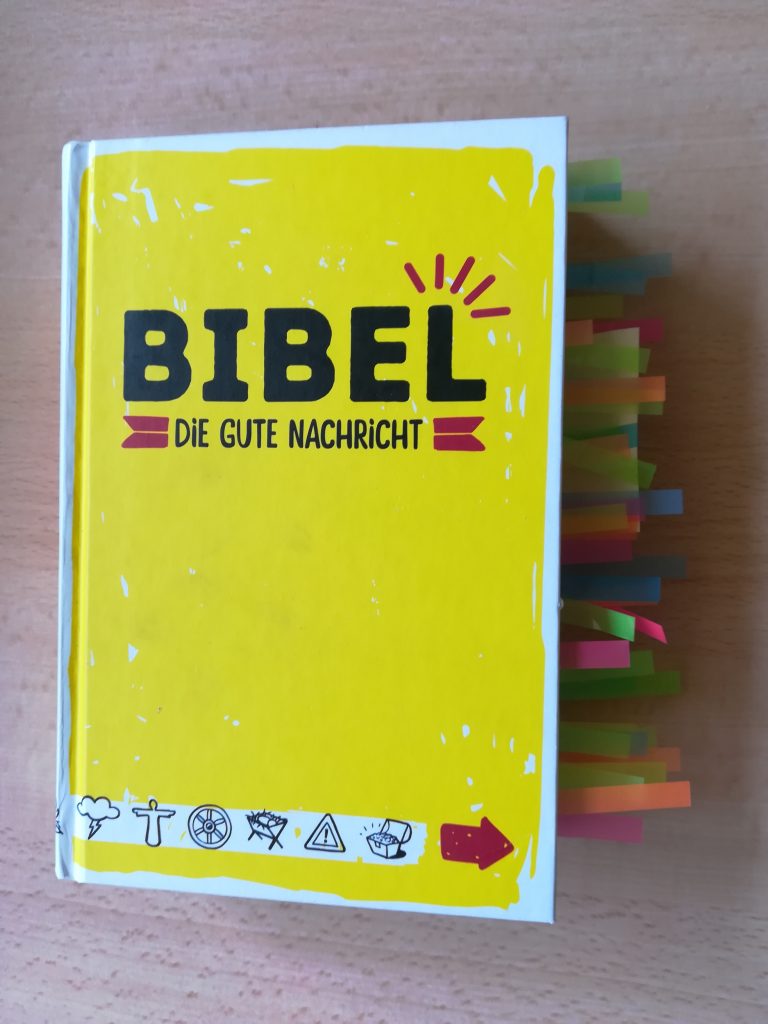
- Packe die markierte Bibel und pro Kind eine Gummibärchenpackung in ein Schuhkarton (soll ein Geschenk darstellen), mache eine Schleife drum und stelle es etwas verdeckt z.B. unter einen Stuhl.
- Lege die übrigen Gummibärchenpackungen zurecht. Mache eine erste Tüte auf.
„Hallo Kinder, hier könnt ihr euch ein Gummibärchen verdienen. Ihr habt die Aufgabe, 5 Liegestütze zu machen.“ Nachdem die Kinder die Aufgabe erfüllt haben, erhalten sie ihren Lohn nach ihrer Leistung. Jedes Kind bekommt so viele Gummibärchen, wie es Liegestütze geschafft hat, max. 5.
Frage an die Kinder: „Ist das Gnade, das, was wir hier gerade gemacht haben?“ Die Kinder Antworten auf die Frage.
Danach erklärst du das Wort Gnade nochmal so, dass es alle verstehen können. „Das Wort Gnade kommt von „gratia“. Das bedeutet für uns sowas wie „Gratis“, also kostenlos, umsonst, geschenkt ohne irgendeine Leistung. Nicht einmal eine Liegestütze muss man leisten. Sonst wäre es ja nicht gratis.“
Jetzt holst du den Schuhkarton hervor machst es geheimnisvoll auf und schenkst jedem Kind eine Tüte Gummibärchen und sie dürfen, wenn sie wollen, diese sofort aufmachen und essen. Während die Kinder essen, holst du die Bibel aus dem Schuhkarton.
„Seht ihr diese Bibel? Die ist an super vielen Stelle markiert. Überall geht es um Gnade, um das was Gott uns schenkt. Gnade muss also etwas sehr Wichtiges sein.
In der Geschichte heute ging es um eine ganze Stadt, die Gnade von Gott bekommen hat. Wir lesen nochmal einen Vers aus der Bibel.“
Ließ aus der markierten Bibel den Vers Römer 10, 6 und bespreche ihn mit den Kindern.
„So ist Gott. Das finde ich toll, dass er die Stadt nicht einfach vernichtet hat. Gnade heißt, wenn du wirklich Mist gebaut hast, vergibt dir Gott trotzdem. Dafür musst du nichts leisten “
Material:
- Kleine Gummibärchenpackungen: für jedes Kind eins plus nochmal 2 Packungen je Kleingruppe.
- Schuhkarton
- Geschenkband
- Marker
- Post-Its
- Bibel mit markierten Bibelstellen
Station 4: Spiel „Schnick Schnack Schnuck Wurm“
Die Kinder verteilen sich im Raum, sodass jeweils zwei Kinder sich gegenüberstehen. Der Mitarbeiter gibt ein Startzeichen, woraufhin die Kinder mit jeweils dem gegenüberstehenden Kind anfangen, Schnick, Schnack, Schnuck (Schere, Stein, Papier) zu spielen. Jedes einzelne Duell geht solange, bis jemand dreimal gewonnen hat. Das Kind, das dabei verliert, kriecht dem Gewinner-Kind unter den Beinen durch, schließt sich dem Gewinner-Kind an und hält sich an seiner Schulter fest. Ab sofort sind sie ein Wurm. Die Kinder, die nicht der Kopf des Wurmes sind (alle die nicht an erster Stelle stehen – sind der Kopf des Wurms) sollten dann die Person anfeuern die vorne Schnick Schnack Schnuck spielen… Der Gewinner sucht sich einen anderen Wurm aus, der frei ist und beginnt eine neue Runde Schnick Schnack Schnuck. Die Kinder, die Teil des Verlierer-Wurms waren, kriechen alle unter allen Kindern des Gewinner-Wurms durch und schließen sich diesem an. Die Kinder, die zu dem Wurm gehören, folgen ihm. Das Spiel endet, wenn nur noch zwei Gruppen gegenüberstehen und einer von ihnen gewinnt und es so nur noch einen Wurm gibt.
Am Ende des Spiels könnt ihr darauf hinweisen, dass Gnade auch bedeutet, sich mit den anderen mitzufreuen. So hat das Anfeuern und Mitjubeln noch eine ganz andere Bedeutung.
Tipp: Die Runde kann relativ schnell vorbei sein, deshalb kann man den Kindern eine zweite Chance geben und das Spiel noch einmal spielen. Vielleicht weist man nochmal konkret darauf hin, dass das Anfeuern und Mitjubeln auch eine Art der Gnade sein kann und man eine zweite Chance bekommt.
Station 5: Gespräch „Interview“
Bei dieser Station sollen die Kinder sich gegenseitig interviewen. Dafür setzten sich die Kinder in einen Kreis. Danach gibt der Mitarbeiter die Mikrofon Attrappe mit dem Fragezettel einem Kind, dieses stellt die erste Frage seinem linken Nachbarn (Uhrzeigersinn) und darf es somit Interviewen. Wenn das andere Kind fertig geantwortet hat gibt er das Mikrofon an die linke Person weiter, die daraufhin die nächste Frage an den nächsten stellt. So wird einmal rund herum jeder gefragt. Wenn noch Zeit da ist, wird eine zweite Runde gestartet.
Vorbereitung: Die Fragen auf einen Zettel schreiben
Fragen:
- „Was
denkst du über Jona? Wie würdest du ihn beschreiben?“ - „Was
denkst du über die Stadt Ninive? Haben sie eine zweite Chance verdient?“ - „Wie muss
sich Jona gefühlt haben, als Gott den Baum zerstört hat?“ - „Was ist
deine Meinung darüber, dass Gott den Baum zerstört hat?“ - „Was ist
für dich ein Geschenk?“ - „Wann und
wem hast du etwas Geschenkt?“ - „Wann hat
dir jemand mal eine zweite Chance gegeben?“ - „Wann
hast du jemandem eine zweite Chance gegeben?“
Variante für 1.und 2. Klasse:
Die Fragen werden vom Mitarbeiter gestellt. Die Kinder können sich melden und der Mitarbeiter nimmt die Kinder dran. Dabei darauf achten, dass jedes Kind eine Chance hat, dranzukommen.
Material:
- Mikro (-Attrappe)
- Zettel mit Fragen
1. Erklärung zum Text:
Verse 11+12: Die Vorgeschichte. Die Chronik-Bücher haben ein großes Interesse am Tempel. Schon unter David (1. Chr 17ff) wird intensiv über den Tempelbau gesprochen, der dann von Salomo in Angriff genommen wird. 2. Chronik 5-7 schildert die Einweihung des Tempels und Salomos Dankgebet. Der vorliegende Text enthält das daran anschließende Gespräch Gottes mit Salomo.
Verse 13-16: Krise und Verheißung. Der Text rechnet mit Krisensituationen, die das Volk Gottes durchleben wird. Auch diese Krisen werden als Handlungen Gottes verstanden (V. 13). Demgegenüber steht die Verheißung der Gegenwart Gottes in seinem Tempel für alle Zeit. Auf das Gebet des Volkes, das im Vertrauen auf diese Gottesgegenwart im Tempel gesprochen wird, folgt eine besondere Verheißung: Gottes ganze Aufmerksamkeit gilt dem Volk, das sich im Tempel an ihn wendet. Sein Name ist dort, seine Augen sind dort, sein Herz ist dort (V. 16).
Verse 17+18: Verantwortung und Verheißung des Königs. An David und seine Nachfolger ergeht eine besondere Verheißung (Erwählung, Begleitung, ewiges Königtum), mit der jedoch eine besondere Verantwortung einher geht. Gott knüpft das Versprechen des ewigen Königtums (V. 18) an das Verhalten Salomos (V. 17): Nur wenn Salomo alles tut, was Gott befiehlt, wird das Königtum Bestand haben.
Verse 19–22: Gericht. Im Hinblick auf das Volk wird verkündet, dass ihnen das Gericht Gottes droht, wenn sie gegen seine Gebote verstoßen und anderen Göttern dienen (V. 19). Israel wird aus seinem Land vertrieben; es wird zum Gespött der Völker (V. 20). Der Tempel, auf dem doch die Verheißung Gottes liegt, wird dann nur noch eine stummen Bauruine sein (V. 21). Alle Welt wird sagen: “Dies ist geschehen, weil Israel seinem Gott nicht gehorcht hat” (V. 22).
Historische Einordnung:
Vermutlich sind die Chronik-Bücher erst nach der Zeit des babylonischen Exils verfasst worden. Die Leser wissen aus der Geschichte, dass weder die Könige noch das Volk dem Willen Gottes und der Predigt der Propheten gehorcht haben. Israel wurde erobert und zerstört, der Tempel ging in Flammen auf, das Volk wurde in die Verbannung geführt. Nach 50 Jahren durften sie einen Neuanfang wagen (vgl. 2. Chr 36; Esra 1ff). Die Leser sollen aus der Geschichte ihrer Vorväter lernen und es jetzt besser machen. Insofern stellt die Gottesrede in 2. Chronik 7 einerseits einen Geschichtsrückblick dar, und andererseits einen warnenden Ausblick auf die jeweilige Gegenwart des Lesers.
2. Bedeutung für den heutigen Hörer
Gott redet. Unser Abschnitt ist – abgesehen vom Einleitungsvers – ein Monolog Gottes. Er gibt Anweisungen. Er kündigt Salomo an, was passieren wird, wenn er oder das Volk sich von ihm abwenden. Wie gehen wir heute mit solchen Warnungen und Gerichtsreden um? Gelten sie uns? Oder hat sich das durch Jesus alles erledigt? Dürfen wir solch einem Text der Bibel vielleicht sogar widersprechen?
Ich denke in zwei Richtungen:
a) Gottes Verheißungen gelten. Er droht uns nicht mit der Vernichtung, wenn wir sein Gebot übertreten. Wir scheitern, wie Israel gescheitert ist. Wir sind nicht ohne Sünde. Aber Jesus hat das Gericht getragen. Er ist der Eine, der allein ohne Sünde ist (Hebr 4,15). Er nimmt unsere Schuld auf sich und beschenkt uns mit seiner Gerechtigkeit (2 Kor 5,21; Kol 2,14). Wir werden gerecht vor Gott ohne Werke des Gesetzes, allein aus Glauben, allein aus Gnade, allein durch Christus (Rö. 3,21-28). Daher könnten wir sagen: 2.Chronik 7 geht uns nichts an.
Warum lesen wir dann solche Bibeltexte? Warum brauchen wir das Alte Testament? Das Alte Testament zeigt uns die Geschichte Gottes mit seinem Volk. Es berichtet von seiner leidenschaftlichen Liebe und von seinem Zorn, der die Konsequenz seiner Liebe ist. Wir sehen, wie Gott um sein Volk ringt: Er lockt, er wirbt, er mahnt, er droht, er straft und er fängt immer wieder neu mit seinem Volk an. Wenn wir diese Texte – gerade auch die Gerichtsworte – lesen, erkennen wir die Heiligkeit Gottes.
b) Auch das Neue Testament will, dass der Glaube an Gott und Jesus konkrete Auswirkungen im Leben hat. Wir stehen in der Gefahr, immer nur die “schönen” Texte der Bibel zu lesen. Wir hören gerne, dass Jesus uns liebt, dass er heilt, dass er sucht und findet, dass bei ihm jeder angenommen ist. Dabei übersehen wir schnell, dass auch das Neue Testament eine große Anzahl von Weisungen und Mahnungen für die Christen enthält (vgl. u.a. Mt 7,21.24-27).
Vielleicht können wir den Text verstehen, wenn wir angstfrei an ihn herangehen. Dies gelingt uns mit dem Wissen um Jesu Liebe für uns vom Neuen Testament her. Dann sehen wir nicht den erschreckenden Gerichtstext, sondern den Anspruch unseres Gottes, der einen gemeinsamen Weg mit uns gehen will. Des Gottes, der den ersten Schritt auf uns zu macht und immer wieder neu mit uns anfängt. Der uns aber auch auffordert, uns verändern zu lassen.
3. Methodik für die Gruppe
3.1 Der Text wird erschlossen
Folgende zwei Methoden möchte ich gerne für das gemeinsame Erarbeiten des Textes vorschlagen. Sie können entweder nacheinander oder einzeln durchgeführt werden, je nachdem, wie viel Zeit euch zur Verfügung steht.
Hör zu!
Für diese Methode ist es wichtig, dass jede/r Teilnehmende einen Zettel und einen Stift vorliegen hat. Auf dem Zettel sollen die folgenden Fragen notiert werden:
Jetzt liest der Gruppenleiter den Bibeltext vor. Wichtig: Die anderen hören zu, haben den Text aber nicht vor sich liegen. Danach dürfen Notizen zu den genannten Fragen gemacht werden.
- Was ist bei mir hängen geblieben?
- Welche Bilder haben sich in meinem Kopf festgesetzt?
Tauscht Euch aus. Ihr werdet staunen, wie sehr sich die Eindrücke verschiedener Personen vom gleichen Text unterscheiden werden. Diese Eindrücke werden gesammelt, aber nicht kommentiert.
Verheißung und Warnung!
Nach einer ersten Lesung des Textes hat jeder Zeit für Markierungen. Zunächst teilt jeder seine hervorgehobenen Worte und Sätze, die als Verheißungen verstanden wurden, mit den anderen. Diese werden nicht kommentiert. Einer zweiten Lesung des Textes folgt die Runde mit den Warnungen. Nach einem dritten Lesen des Textes werden die verschiedenen markierten Stellen diskutiert.
Jede/r Teilnehmende bekommt den Bibeltext auf eine DIN A4-Seite vergrößert ausgedruckt. Zusätzlich erhält jeder zwei Markierungsstifte in unterschiedlichen Farben. Mit dem einen Stift sollen alle Verheißungen, mit dem anderen alle Warnungen im Text hervorgehoben werden.
Denkt darüber nach, was für Konsequenzen sich konkret für euer persönliches Glaubensleben ergeben. Was wollt ihr für euch und für eure Gruppe lernen?
3.2 Fragen zum Bibeltext
Die hier aufgelisteten Fragen wurden aus dem Spiel “Slant. Der etwas andere Blickwinkel” ausgewählt, das beim Born-Verlag erschienen ist.
- Welchem Rohstoff gleicht der Bibeltext deiner Meinung nach am ehesten? (Gold, Erdöl, Granit,…)
- Welche Band würde deiner Meinung nach diesen Bibeltext am besten interpretieren können?
- Welche Aussage des Textes flößt dir den größten Respekt ein?
- Welche Frage zum Text würdest du Gott gerne stellen?
- Was passt nicht so richtig zu deinem bisherigen Bild von Gott?
- Bewerte auf einer Skala von 1 bis 5: Wie relevant für dein Leben ist der Bibeltext? Warum?
- Wo berührt dieser Bibeltext deinen Alltag?
3.3 Hinweis:
Solltet ihr Schwierigkeiten mit der Gerichtsaussage des Textes haben, empfehle ich dem Leiter der Gruppe, den Punkt 2 (Bedeutung für den heutigen Hörer) als Erklärung und Denkansatz weiterzugeben und zu erläutern.
3.4 Schluss
Die Einheit darf mit einer Gebetsgemeinschaft beendet werden, in der eure Erkenntnisse und Fragen vor Gott gebracht werden.
Eine Gruppenstunde rund ums Überraschungsei
Kurzbeschreibung
Ein lustiger Abend rund ums Überraschungsei.
Da auch Jugendliche noch auf Überraschungseier stehen und manchmal gerne einen albernen
Abend verbringen, bei dem man mal wieder etwas kindisch sein darf, ist der folgende Abend auch
für Jugendliche geeignet. Wer allerdings gerade Teenies in seiner Gruppe hat, die sehr darauf be-dacht sind, keine Kinder mehr zu sein, sollte mit diesem Abend noch etwas warten, bis sie „drüberstehen“ und ihre Freude an Überraschungseiern und Überraschungsspielchen genießen können, ohne sich vor den anderen zu genieren…
Teilnehmerzahl
10 bis 50 Jugendliche
Hinweis für die Mitarbeitenden
Es werden für den Abend relativ viele leere Überraschungseier gebraucht. Am besten rechtzeitig mit dem Sammeln beginnen und im Freundeskreis und bei Bekannten und Verwandten mit kleinen und größeren Kindern den Bedarf an den leeren Überraschungseiern anmelden.
Hilfreich ist auch ein Aushang am schwarzen Brett in der Schule oder am Arbeitsplatz.
Ei, Ei, wer kommt denn da?
Alle Jugendlichen bekommen zur Begrüßung ein leeres Überraschungsei und schreiben auf einen
Papierstreifen ihren Namen. Der Papierstreifen wird in das Überraschungsei gesteckt. Das Ei dann ins bereitstehende Körbchen gelegt.
Eierlauf der besonderen Art
Die Jugendlichen ziehen irgend ein Ei aus dem Körbchen und schauen nach, welcher Name in dem Ei verborgen ist. Diese oder dieser Jugendliche wird nun gesucht und auf originelle Art (Wangen zwicken, Ellbogen reiben, …) begrüßt.
Der Namensstreifen kommt wieder ins Ei und sobald die Musik einsetzt, wandern alle mit den gezogenen Eiern durch den Raum und bewegen sich zur Musik. Während dieser Phase werden ständig die Eier mit den vorüberziehenden anderen Jugendlichen getauscht. Beim nächsten Musikstopp öffnen alle wieder das Ei und suchen die Person, deren Name nun auf dem Zettel steht. Diesem Jugendlichen wird ein Kompliment gemacht. Und wieder setzt die Musik ein und der Eiertausch beginnt …
Je nachdem, ob sich die Gruppe schon gut kennt oder die Jugendlichen sich eher noch fremd sind, ob sie sich schnell kindisch vorkommen oder eher gerne herumalbern, können die Aufgaben bei den Musikstopps angepasst werden. Bei unbekannten Jugendlichen eher
• Namen
• Hobbies
• Lieblingsessen
• Lieblingsstar/Lieblingsmusikstil
• Schule
und Ähnliches austauschen lassen.
Bei einer Gruppe, die schon länger zusammen ist, gehen auch Aktionen, wie z. B. gemeinsam den Teil eines Hits singen, sich umarmen oder Ähnliches.
Eiergruppenfindung
Alle Überraschungseier mit den Namensstreifen kommen in die Mitte, die Spielleitung teilt sie in
zwei Häufchen. Dadurch entstehen auf ganz undramatische Weise zwei Gruppen. Jede Gruppe darf sich nun noch einen lustigen Eier-Gruppennamen überlegen.
Hinweis: Bei sehr großen Gruppen ist es ratsam, 3 oder 4 Gruppen einzuteilen, damit die Kleingruppengröße nicht zu groß wird.
Eierlauf nach herkömmlicher Art
Die beiden Gruppen stellen sich zum Staffellauf auf. Jeweils eine Person pro Gruppe startet an der
Startlinie, den Löffelstiel in der Hand (Achtung, nur am Stielende festhalten ist erlaubt, nicht vorne am Löffel!), auf dem Löffel liegt ein Überraschungsei. Eine bestimmte Strecke ist zurück-zulegen.
Wer will kann sie durch Hindernisse erschweren. Am Ende der Strecke steht eine Markierung, die umrundet werden muss, dann den ganzen Weg zurückgehen und die nächste Person der Gruppe
abschlagen.
Problem: Wenn das Ei herunterfällt, muss die betreffende Person nochmal an der Startlinie
beginnen. Gewonnen hat die Gruppe, die als erstes fertig ist.
Eierweitwurf
Eine Person nach der anderen stellt sich an die Startlinie und wirft ein Überraschungsei. Der weiteste Werfer hat gewonnen. Wer möchte, kann auch alle Wurfergebnisse der Gruppe zusammenaddieren und so ermitteln, welche Gruppe am wurfstärksten ist.
Weitere Alternative: Beide Gruppen gehen auf eine Wiese, Fußballfeld o.Ä. Jeweils eine Person pro Gruppe beginnt an der Startlinie und wirft das Ü-Ei. Am „Landeplatz“ des Ü-Eis kommt der
nächste Spieler dran und wirft seinerseits. So kann auch ermittelt werden, welche Gruppe die wurfstärkste ist, und die Länge wird noch konkreter sichtbar, ist witziger.
Ei in Zeitungstext umkreisen
Jeder Gruppe wird entweder eine Zeitungsseite (möglichst die gleiche wegen Chancengleichheit) oder eine ganze Zeitung überreicht, ebenso einen oder mehrere Textmarker. Aufgabe ist es, in 2 Minuten so oft wie möglich das Wort „Ei“ anzustreichen. Es gilt auch das „ei“ in Worten, z. B. „eine“, „Papagei“, „Kreide“ o. Ä.
Ü-EI-Glücksgriff
Je nach Stand der Gruppenkasse gibt es für alle Jugendlichen ein Ü-Ei oder eben nur eine kleinere Anzahl pro Gruppe. Auf das Startsignal der Spielleitung werden die Ü-Eier ausgepackt und das Schokoladenei vorsichtig an der Nahtstelle auseinander getrennt. Jede vollständige Schoko-ladeneihälfte gibt anschließend einen Extrapunkt. Dann wird das gelbe Überraschungsei geöffnet
und der Inhalt zusammengebaut. Die Gruppe, die zuerst alle „Eierinhaltsspielzeuge“ zusammen-gebaut hat, hat gewonnen (Joker sind hier natürlich die fertigen Figuren, die nicht mehr zu-sammengebaut werden müssen …).
Überraschungsschokolade
Jede Gruppe erhält folgende Zutaten: Schokoladenhälften vom vorigen Spiel, Butterkekse, Puderzucker, Wasser, Pfirsichhälften aus der Dose und stellt aus Puderzucker und wenig Wasser eine dickflüssige klebrige Masse her.
Die Aufgabe ist, mit den erhaltenen Zutaten in 5 Minuten einen attraktiven Nachtisch zu zaubern.
Der kreativste Nachtisch hat gewonnen – und jede Gruppe darf anschließend ihr Kunstwerk ver-zehren.
Eierzielschießen
Ein bestimmter Punkt wird als Wurfstandort markiert, in einiger Entfernung wird ein leerer Papierkorb aufgestellt, um den Papierkorb herum ein größerer Kreis mit dem Seil gelegt. Jeder Teilnehmende darf nun auf den Wurfstandort stehen und versuchen, das Ü-Ei in den Papierkorb zu werfen. Landet es im Papierkorb, ergibt dies 2 Punkte für die Gruppe, landet es noch im mar-kierten Seil-Kreis, bekommt die Gruppe 1 Punkt.
Überraschungsostereiermalen
Alle Jugendlichen erhalten ein Überraschungsei und jede Gruppe erhält einen einzigen Eddingstift. Aufgabe ist nun, das Ei so schön wie möglich zu bemalen, allerdings müssen später
alle Eier gleich aussehen, jede Person hat nur 20 Sekunden Zeit und kann die anderen angemalten
Eier nicht sehen. Deshalb geht der Malaktion eine Besprechungsrunde voraus. Jede Gruppe muss sich darauf einigen, welches Motiv sie wählt, ob Streifen, Blümchen, Punkte, Hasen oder was auch immer. Es muss so gut wie möglich besprochen werden, wie das fertige Ei später aussehen soll. Denn es wird zum einen Punkte dafür geben, wie ähnlich sich die Eier sehen, und zum anderen, wie schön das Motiv ist. Wurde alles genau besprochen, darf immer nur eine Person pro Gruppe
zur Spielleitung kommen und hat genau 20 Sekunden Zeit, das Ei wie besprochen zu bemalen. Dann setzt sich der oder die Jugendliche neben die Spielleitung und darf keine Kommentare zum nächsten aufgerufenen Maler abgeben; die Spielleitung steckt das bemalte Ei in eine Tasche, damit nicht abgeschaut werden kann. Sind alle mit der Malaktion fertig, werden alle Eier pro
Gruppe ausgelegt und die Jury (Team) entscheidet, welche Eier das schönste Motiv haben und welche sich am ähnlichsten sehen.
Hau weg das Ei
Es wird ausgelost, welche Gruppe beginnt. Die Spielleitung legt eine Bibel oder einen anderen Gegenstand in einiger Entfernung zur Startlinie auf den Boden. Nun wechseln sich die beiden Gruppen ab und immer eine Person soll von der Startlinie aus ein Ü-Ei werfen, schießen, schnipsen… – frei nach Wahl. Aufgabe ist, so nah wie möglich an der Bibel zum Liegen zu kommen. Gewonnen hat die Gruppe, deren Ei am nächsten bei der Bibel liegt (sieht man ja durch die unterschiedlich bemalten Eier). Gibt es ein Unentschieden, wird geschaut, von welcher Gruppe mehr Eier in Bibelnähe liegen. Taktisch klug ist es, wenn man zum einen natürlich versucht,
das Ei so nah wie möglich an der Bibel zu platzieren, zum anderen aber auch, gegnerische Eier aus Bibelnähe wegzuschießen.
Eierschnitzeljagd
Jede Gruppe bekommt ihr erstes Ei ausgehändigt. In dem Ei steckt ein Hinweis, wo das zweite Gruppenei zu finden ist. Wird das zweite Ei gefunden, kann man über ein Rätsel herausfinden, wo das dritte Ei ist, im dritten Ei steht der Hinweis, dass die Spielleitung verrät, wo das vierte Ei
versteckt ist, etc. Je nach gewünschter Spiellänge kann man die Anzahl der Eier und die Schwierigkeit der Hinweise und Rätsel variieren, ebenso ob die Eierschnitzeljagd nur im Haus stattfindet oder im Freien. Die Gruppe, die zuerst das letzte Ei gefunden hat (nur ein letztes Ei für
beide Gruppen, so kann genau ermittelt werden, wer es zuerst gefunden hat), hat gewonnen.
Eierüberraschung
Jede Gruppe bekommt 10 gefüllte Ü-Eier und 10 Kärtchen. Auf den Kärtchen stehen die Füllungen der Eier, z. B. Reis, Zucker, Sand, Split, Perlen etc. Aufgabe ist es nun, durch Schütteln der Eier den Inhalt zu „erhören“ und das richtige Kärtchen neben das entsprechende Ei zu legen. Schwierigkeit: die Gruppe hat nur 2 Minuten Zeit. Welche Gruppe hat die besseren Ohren?
Hinweis: Wem es zu umständlich ist, alles doppelt vorzubereiten, lässt die beiden Gruppen einfach nacheinander antreten.
Eiermemory
Die Überraschungseier liegen auf dem Tisch oder dem Boden, alle Teilnehmenden sitzen außen herum. Nun wird Memory gespielt, immer abwechselnd pro Gruppe. Anstatt Kärtchen auf-zudecken werden Eier geöffnet – immer zwei Eier dürfen geöffnet werden, haben sie unter-schiedlichen Inhalt, werden sie wieder zugemacht und zurückgelegt. Haben sie den gleichen Inhalt, dürfen sie weggenommen werden und die Gruppe darf erneut zwei Eier öffnen. Die Gruppe, die später die meisten Eier erspielt hat, hat gewonnen. Die Eierinhalte dürfen gegessen werden…
Eier-Erkennung
Alle erhalten ein leeres Ü-Ei und stecken zunächst einen Zettel mit ihrem Namen hinein. Dann entscheidet sich jeder und jede Jugendliche für ein Füllmaterial und füllt ein wenig davon in das Ei. Nun wird das eigene Ei geschüttelt und versucht, sich das entstehendene Geräusch ein-zuprägen. Später werden pro Gruppe die Eier durchgemischt und alle versuchen, das eigene Ei herauszufinden. Dieses Spiel wird umso schwieriger, je mehr ähnlich klingende Füllmaterialien angeboten werden. Welche Gruppe hat die meisten Übereinstimmungen?
Eier-Schlange
Auf der einen Zimmerseite ist die Startlinie markiert, dort platzieren sich auch links und rechts die beiden Gruppen, auf der anderen Zimmerseite steht die Spielleitung mit einem großen Korb voller Ü-Eier. Noch mehr Spaß macht es, wenn die „Rennstrecke“ länger ist, d. h. in einem Raum befinden sich die Schlangenbauer, in einem anderen Raum, evtl. sogar in einem anderen Stock-werk, ist der Korb mit den Ü-Eiern (natürlich auch gut im Freien spielbar!). Jede Gruppe benennt
Läufer und 2 Schlangenbauer, bei mehr Teilnehmenden werden die Aufgaben durchgewechselt. Nachdem der Startschuss gefallen ist, rennen die Läufer die Strecke bis zur Spielleitung. Wer vor den Augen der Spielleitung entweder einen Purzelbaum oder 5 Kniebeugen gemacht hat, erhält ein Ü-Ei. Damit rennen die Läufer zurück zu den Schlangenbauern, liefern es ab und rennen
wieder los in Richtung Ü-Eier-Vorrat. Die Schlangenbauer indes stecken die Ü-Eier zu einer langen Schlange zusammen. Das Spiel ist entweder aus, wenn keine Ü-Eier mehr da sind, oder wenn der Schlusspfiff der Spielleitung ertönt. Gewonnen hat die Gruppe mit der längsten zusammen-gesteckten Ü-Eier-Schlange. Einen Sonderpunkt gibt es, wenn man die Schlange anheben kann,
ohne dass sie auseinander fällt.
Kunstwerk
Jede Gruppe bekommt 5 Minuten Zeit, um aus ihren bemalten Ü-Eiern und zusätzlichen „neutralen“ Ü- Eiern ein Kunstwerk zu kreieren. Sie können die Ü-Eier legen und stecken, zusätzliches Befestigungsmaterial wie z. B. Tesa ist nicht erlaubt. Nach den 5 Minuten wird das
Kunstwerk mit einem passenden Namen vorgestellt und erklärt. Das schönste und am meisten „umworbene“ Kunstwerk hat gewonnen.
Eierpuzzle
Dieses Spiel macht am meisten Spaß, wenn drei Räume zur Verfügung stehen: Links und rechts
sitzt je eine Gruppe, im mittleren Raum liegen viele Ü-Eier, in jedem Ü-Ei befindet sich ein Puzzleteil von einem der beiden Puzzle. Nur jeweils die 4 Eck-Puzzleteile wurden nicht verpackt. Jede Gruppe bekommt nun ihre 4 „Puzzleecken“. Aufgabe ist, ihr Puzzle so schnell wie möglich fertig zu stellen, die schnellste Gruppe hat gewonnen. Auf den Startpfiff der Spielleitung rennt eine Person pro Gruppe los und holt ein Ü-Ei aus dem mittleren Raum. Das Ü-Ei darf erst zurück in der eigenen Gruppe geöffnet werden. Kann man es an die bestehenden Puzzleteile anbauen, darf es behalten werden und der Läufer bringt das leere Ü-Ei zurück und legt es zu den anderen gefüllten in die Raummitte. Passt es nicht, kommt es zurück ins Ü-Ei und wird zurückgelegt.
Ein neues Ei wird geholt und die Prozedur beginnt von vorne. Es ist sinnvoll, wenn bei jeder Gruppe eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeit er als Aufpasser dabeibleibt, damit nicht gemogelt wird. Schließlich dürfen nur Teile behalten werden, die direkt angepuzzelt werden können, und man darf auch keine Puzzleteile der anderen Gruppe zurückhalten.
Andacht
Ei-ner kam zurück…
Anspiel zu der Geschichte von den 10 Aussätzigen (Lukas 17, 11-19)
Basteln
Schrilles Ü-Eier-Paradiesvogel- Mobile…
Die Jugendlichen stellen bunte Paradiesvögel her, indem sie zuerst oben in die Überraschungseier mit einer spitzen Schere oder einem Milchdosenöffner ein Loch eindrücken. In dieses Loch der oberen Eihälfte wird der Aufhängefaden gefädelt und innen verknotet. In die untere Eihälfte zum Beschweren etwas Split oder kleine Steine einfüllen, dann das Ü-Ei wieder zusammenstecken.
Nun pro Überraschungsei zwei gleichfarbige Federn als Flügel aufkleben und ein oder zwei Federn als Schwanz – wer will auch noch eine kleinere Feder auf den Kopf als Kopfschmuck. Aus
dem Tonpapier werden Schnabel und Füße ausgeschnitten und aufgeklebt, dann noch die Wackelaugen aufkleben. Nun werden die Paradiesvögel (Anzahl richtet sich nach Größe des Astes…) an einen Ast geknotet und fertig ist das etwas andere Mobile. Je nachdem, wie die Jugendlichen drauf sind, wollen sie das Mobile vielleicht sogar selbst behalten oder ihren jüngeren Geschwistern/Nichten/Neffen … schenken, oder die Mobile werden bei einem Flohmarkt/Weihnachtsmarkt oder Ähnlichem gewinnbringend für die Gruppenkasse verkauft.
Chicken Egg
Im Musikgeschäft muss man für das handliche Rhythmusinstrument bezahlen, heute kann es selbst hergestellt werden. Die Jugendlichen füllen ihr Ü-Ei mit dem Material, das ihnen am besten als Rasselton gefällt. Dann wird das Ei ganz nach Belieben noch schön verziert, bemalt oder beklebt.
1. Erklärungen zum Text
1.1 Zu den Psalmen allgemein
Die Psalmen der Bibel sind wirklich etwas Besonderes – eine Sammlung verschiedenster Gebete, in der sich fast jede Lebenssituation finden lässt. Von ausgelassener Fröhlichkeit, die in bunten Worten Gott als den barmherzigen Schöpfer preist, bis hin zu verzweifelten Hilferufen aus tiefster Dunkelheit und Not. Diese Gebete, die oft als Lieder überliefert wurden, haben eine lange Tradition. Das Psalmenbuch in der Zusammenstellung, wie es uns heute im Alten Testament vorliegt, ist vermutlich nach dem Exil des Volkes Israel gegen 500 v. Chr. entstanden. Die meisten der Gebete waren zu dieser Zeit aber schon länger in Gebrauch gewesen.
Die einzelnen Gebete der Psalmen haben ganz unterschiedliche Entstehungsgeschichten. Einige von ihnen sind von Anfang an für den Gottesdienst gedacht gewesen. Sie dienten der gemeinschaftlichen Anbetung Gottes. Manche Lieder besingen bestimmte historische Ereignisse, in denen Gott konkret eingegriffen hat. Wieder andere sind ganz persönliche Gebete von einzelnen Menschen.
Die Verfasser der Psalmen sind sehr unterschiedlich – Männer und Frauen aus verschiedenen Bildungsschichten und Regionen. Die Psalmen dokumentieren, wie Menschen durch die Zeiten mit Gott gesprochen haben, wie sie ihm begegnet sind und wie sie ihren Glauben gelebt haben. In diesem Gebetsbuch finden Menschen seit Jahrtausenden Trost, Zuspruch und Erbauung.
Im Neuen Testament werden die Psalmen oft zitiert. Etwa ein Drittel der alttestamentlichen Zitate im Neuen Testament stammen aus den Psalmen. Das weist darauf hin, dass die Psalmen für die Christen von Anfang an eine sehr große Rolle gespielt haben.
1.2 Das Besondere an Psalm 6
Der sechste Psalm wird mit König David in Verbindung gebracht. Im ersten Vers finden wir neben dem Hinweis zum Autor auch Anweisungen für die Musiker. Traditionell gehört dieser Psalm zu den Klagepsalmen. Es finden sich in diesem Gebet verschiedene Themen: Krankheit, Zweifel, Anfeindung, die Frage nach Gottes Zorn und Strafe usw. Der konkrete Auslöser der Klage wird allerdings nicht klar benannt. Drei kurze Hinweise zum Text:
a) Perspektivwechsel
Der Beter kennt Gott und er spricht ihn gleich mit dem ersten Wort direkt an. Es ist sehr hilfreich, die Entwicklung der Anrede im Verlauf des Psalms zu beobachten:
- V.2-4,5 f.: Am Anfang steht der Beter mit seiner Not Gott gegenüber. Er klagt Gott sein Leid.
- V.7 f.: Gott kommt hier nicht vor – es ist der Tiefpunkt des Psalms. Im Fokus steht das eigene Leid.
- V.9-11: Hier wird nicht mehr Gott angeredet – die Perspektive verändert sich. Der Beter weiß Gott auf seiner Seite und spricht plötzlich die Feinde an.
b) Straft Gott, lässt er das Übel nur zu oder hat er nichts damit zu tun?
“Herr, strafe mich nicht voller Zorn! Schlag mich nicht in deiner Wut!” (Ps 6,2)
Grundsätzlich wird “Züchtigung” (Strafe) im AT nicht nur negativ verstanden. Gott wird eine Erzieherrolle zugeschrieben. Das Thema ist allerdings äußerst komplex, da jeder Autor auch ein Kind seiner Zeit ist und jeweils den aktuellen Erziehungsstil vor Augen hat.
Es scheint aber so, dass der Psalmbeter sich vorstellen kann, dass Gott ihn zum Beispiel die Konsequenzen für falsches Handeln spüren lässt. Das Problem ist jedoch größer: Der Beter fühlt sich existenziell bedroht. Sein Leben steht auf dem Spiel. Wendet sich Gott ganz von ihm ab? Er weiß – wenn das geschieht, dann wird er sterben.
Eine wirklich zufriedenstellende Antwort auf die Frage nach dem Leid und seinem Ursprung habe ich noch nicht gehört. Was wir von dem Psalmbeter aber lernen können ist, dass er keine wissenschaftliche Abhandlung darüber beginnt, sondern seine Not vor Gott ausbreitet.
c) Was geschieht nach dem Tod (AT-Theologie)?
Im AT finden sich zu diesem Thema verschiedene theologische Stränge. Das Jenseits spielt aber im Wesentlichen keine tragende Rolle. Der Gerechte stirbt alt und lebenssatt (Abraham in 1. Mo 25,8; Isaak in 1. Mo 35,29; Hiob in Hi 42,17; …) – das ist das Lebensziel.
Das Totenreich (hebräisch “Scheol”), das in Vers 6 genannt wird, ist der Ort, an den die Seelen aller Gestorbener kommen. Die Vorstellungen darüber sind sehr vielfältig, in der Regel aber nicht mit der Idee eines Lebens nach dem Tod (wie es in der christlichen Tradition zu finden ist) verknüpft.
Klar ist: Der Psalmbeter will am Leben bleiben! Außerdem können in seiner Vorstellung diejenigen, die tot sind, Gott nicht mehr loben und ihm auch nicht danken.
2. Bedeutung für heute
Vielleicht geht es dir so, dass du mit dem Psalm nicht direkt etwas anfangen kannst. Der Psalmbeter ist sehr emotional. Er ist erschöpft, am Ende seiner Kräfte und während er das Leid trägt, fragt er sich, ob es nicht sogar Gott ist, der ihn straft. Das ist wohl seine größte Not – meint Gott es noch gut mit ihm?!
Der konkrete Grund für die Klage bleibt offen, vielleicht auch, damit du mit deinem Leben, mit deinen Anliegen in diese Lücken hineinkommen kannst.
Ich gebe zu, dieser Psalm überfordert mich in meinem konkreten Gebetsleben. Das liegt vermutlich an meinem kulturellen Kontext, der insgesamt eher gemäßigt ist. Ein weiterer Grund ist bestimmt auch die eher gemütliche Gesamtsituation, in der ich leben darf.
Im Nachdenken über diesen Psalm werde ich dankbar dafür, dass ich im Moment keinen konkreten Anlass für solch eine intensive Klage habe. Es macht mich aber auch betroffen, weil ich weiß, dass diese Worte genau in diesem Moment vielen meiner christlichen Geschwister aus dem Herzen sprechen. Darum bete ich den Psalm auch dann, wenn er gerade nicht in meine persönliche Situation passt. Ich bete ihn für diejenigen Menschen, die auf der Flucht sind, die verfolgt werden, die unter schwerer Krankheit leiden und mit ihren Kräften am Ende sind.
Es lohnt sich, mit den Worten der Psalmen zu beten, zu singen und über Gott nachzudenken. Dabei ist es wichtig, dass man die verschiedenen Gotteserfahrungen, die hier verarbeitet werden, erst einmal für sich stehen lässt und wahrnimmt. Wer die schwierigen Aussagen über Gott sofort relativieren will, beraubt sich einer Glaubenstiefe, von der man auch in schwierigen Zeiten zehren kann.
3. Methodik für die Gruppe
3.1 Ankommen
Emotionen
Wie geht es dir heute? Gut? Geht so? Schlecht? Es ist zunehmend so, dass viele Menschen nur sehr wenige Vokabeln haben, mit denen sie ihre Gefühle beschreiben können. Es ist hilfreich, wenn wir für das, was wir empfinden, wieder Worte finden.
Als Einstieg könntet ihr in einer kurzen, spontane Runde ins Gespräch darüber kommen, wie es euch gerade geht. Als Hilfestellung sind Karten mit verschiedenen Gefühlsadjektiven hilfreich. Manchmal helfen auch die dazugehörigen Emoticons.
3.2 Text wahrnehmen
Der vorliegende Bibeltext beinhaltet starke Emotionen. Hier einige Vorschläge, wie man sich dem Psalm mit der Gruppe nähern kann, um den Inhalt erst einmal wahrzunehmen.
Psalmenschnipsel
Drucke den Psalm mehrmals auf festem Papier in großen Schriftart aus und zerschneide die einzelnen Verse. Jeder darf sich 1-2 Verse nehmen. Legt eure Verse vor euch hin und tauscht euch darüber aus, warum ihr welche Verse gewählt habt. Anschließend könnt ihr darüber sprechen, warum manche Verse nur selten oder gar nicht gewählt wurden.
Im Text markieren
Jeder markiert für sich folgende Inhalte im Psalm: Bitten, Aussagen über den Beter, Aussagen über Gott. Was spricht dich an, was löst Widerstand aus?
Farbe bekennen
Besorgt euch das Spiel „Farbe bekennen“ (lohnt sich auf jeden Fall!)
Eine mögliche Spielvariante:
Geht den Psalm Vers für Vers durch. Nach jedem Vers legt jeder verdeckt eine der Karten mit einer Reaktion auf das Gehörte ab. Auf Kommando drehen alle um. Kommt darüber ins Gespräch, warum ihr gerade diese Karte gelegt habt. Der Vorteil dieser Methode ist, dass sich jeder äußern kann und zwar bevor er von den vorhergehenden Äußerungen beeinflusst wurde.
3.3 Mit Gott im Gespräch
Wenn man sich mit Psalmen beschäftigt, ist es wichtig, dass man nicht nur über die Psalmen spricht, sondern auch gemeinsam einübt, die Psalmen zu nutzen. Hier einige Beispiele:
Sich Worte leihen – Fürbitte
Manchmal weiß man nicht, was man in einer bestimmten Situation sagen oder beten soll. So geht es mir, wenn Menschen, die mir nahe stehen in große Not geraten (Krankheit, Todesfall, …).
Die Psalmen sind voller Worte und Formulierungen, die ich mir in solchen Situationen zueigen machen kann.
Für andere Beten
Besorge im Vorfeld eine Übersicht der Nachrichten der letzten Woche. Lest sie vor und betet dazwischen immer wieder den Psalm. Vielleicht kennt ihr auch jemanden persönlich, dem es gerade genauso geht wie dem Psalmbeter . Nennt den Namen vor Gott und betet den Psalm oder einen Teil des Psalms.
Eigenen Psalm verfassen
Wie würde denn dein ganz persönlicher Psalm heute lauten? Versuch doch mal, selbst ein Gebet aufzuschreiben. Schreiben hilft, sich zu fokussieren und auf den Punkt zu kommen. Es dauert manchmal, bis eine Formulierung das trifft, was ich gerade empfinde und ausdrücken will, aber genau diese Zeit ist besonders wertvoll. Ich bin schon häufig von meinem eigenen geschriebenen Gebet überrascht worden.
Psalm singen
Es ist gar nicht einfach, Lieder zu finden, die Klagepsalmen verarbeiten. Dabei würden ein paar modernere Klagelieder unseren Gemeinden und Kreisen wirklich guttun, weil sie uns Worte leihen könnten, die uns helfen, unsere Traurigkeit auszudrücken und zu verarbeiten.
Wie dieser Psalm wohl geklungen hat, als er im Tempel in Jerusalem gesungen wurde?
Welches Lied (z. B. aus den Charts) fällt dir dazu ein?
- Wie soll ein Mensch das ertragen – Philipp Poisel
- Wenn das Liebe ist – Glashaus
- Symphonie – Silbermond
- Abschied nehmen – Xavier Naidoo
Lieder zum Thema:
- “Herrgott, wie lang (Du suchst mein Herz heim bei Nacht)” (Matthias Stempfle)
- “How long, oh Lord” (FJ! 3, Nr 108)
- “Herr, erbarme dich” (FJ! 4, Nr. 24)
Kleine Such- und Versteckspiele mit österlichem Touch
Vor vielen Jahren, ich war vielleicht neun Jahre alt, waren wir am Ostersonntag im Wald spazieren. Meine Brüder und ich stromerten durchs Unterholz, während die Erwachsenen langsam über die Wege schlenderten. In diesem Wald, an diesem Tag, haben wir nochmal irgendwie an den Osterhasen geglaubt, denn auf einmal haben wir überall im Wald Ostereier gefunden. Zwar hatten wir von Anfang an die Erwachsenen im Verdacht, doch wir konnten trotz intensiver Beobachtung niemanden auf frischer Tat beim Verstecken ertappen. Für alle, die für die Gruppenstunde oder auch eine Freizeit, auf der Suche nach geeigneten Versteckspielen für die Osterzeit sind, habe ich variabel einsetzbare Osterspiele zusammengestellt. Sie lassen sich problemlos an die eigenen Bedürfnisse anpassen und können auch mit kleinen Gruppen gespielt werden.
Spiele im Haus
Eierschmuggel
Ein Spieler wird zum Zöllner ernannt, die anderen Spieler laufen mit geschlossenen Augen umher. Ein Spieler bekommt das Ei und hält es in seiner Hand verborgen. Das Ei wandert ständig zwischen den Spielern hin und her. Hat der Zöllner einen Verdacht, tippt er dem Spieler auf die Schulter und lässt sich von ihm seine Hände zeigen. Hat er das Ei, wird er der neue Zöllner, hat er es nicht, muss sich der Zöllner entschuldigen und weitersuchen.
Der Räuber im Hasenbau
Ein Stuhlkreis bildet den Hasenbau, der so groß sein muss, dass man durch die Lücken zwischen den Stühlen durchgehen kann. In der Mitte liegt ein Osterei mit einem Tuch abgedeckt. Ein Spieler ist der Räuber und wird vor die Tür geschickt, währenddessen wird heimlich ein Wächter bestimmt. Der Räuber betritt nun von außen den Hasenbau und versucht, den Schatz zu stehlen. Sobald er ihn berührt, darf der Wächter aufstehen und versuchen, den Räuber noch innerhalb des Stuhlkreises abzuschlagen. Schafft er das, bekommt er den Schatz, andernfalls bekommt ihn der Räuber. Um noch mehr Action ins Spiel zu bringen, können auch mehrere Wächter ernannt werden.
Stumme Ostereiersuche
Alle Spieler sitzen mit geschlossenen Augen in einem Stuhlkreis. Ein Mitarbeitender versteckt im Raum ein Osterei und zwar so, dass es mit bloßem Auge noch sichtbar ist. Dann machen sich alle auf die Suche und zwar ohne miteinander zu reden und möglichst unauffällig. Wer das Ei entdeckt hat, darf sich wieder auf seinen Stuhl setzen.
Osterhasenjagd
Innerhalb eines Stuhlkreises versucht ein Jäger den Osterhasen zu fangen. Der Jäger hat dabei die Augen verbunden, der Osterhase bekommt ein Glöckchen ans Hand- oder Fußgelenk gebunden. Mithilfe des Klingelns kann sich der Jäger orientieren. Die Jagd ist beendet, sobald der Jäger den Osterhasen berührt hat. Als Variante kann man den Stuhlkreis größer oder auch kleiner machen.
Osterhasen auf Zehenspitzen
Bei diesem Spiel muss es im Raum ganz still sein. Die Spieler sitzen in einem Stuhlkreis und haben die Augen geschlossen. Nun schleichen sich von außen ein paar andere Spieler oder Mitarbeitende – die Osterhasen – an den Stuhlkreis heran und stellen sich hinter einen Stuhl. Wenn ein Spieler nun meint, dass einer der Osterhasen hinter ihm steht, hebt er die Hand, lässt die Augen aber noch geschlossen. Auf ein Zeichen des Spielleiters dürfen alle nun die Augen öffnen und schauen, ob sie richtig geraten haben.
Fehler im Nest
Die Spieler sitzen auf dem Boden um das Osternest herum, das mit einem Tuch bedeckt ist. Der Spielleiter entfernt nun das Tuch vom Osternest. Alle Spieler haben genau eine Minute Zeit, sich alle Gegenstände im Osternest einzuprägen, danach legt der Spielleiter wieder das Tuch darüber. Während alle Spieler mit geschlossenen Augen warten, entfernt der Spielleiter etwas aus dem Nest oder legt etwas Neues dazu. Die Spieler öffnen wieder die Augen und versuchen zu erraten, was sich am Nest verändert hat. Wer glaubt die Lösung zu kennen, greift sich den Plüschhasen, hält ihn hoch und äußert seinen Verdacht. Hat er Recht, beginnt eine neue Runde. Liegt er daneben, scheidet er aus und die anderen Spieler dürfen weiter raten.
Spiele im Freien
Fehl am Platz
Verschiedene Gegenstände (z. B. Tennisschläger, Boxershorts, Kochlöffel) werden mit Nummern versehen und in einem abgegrenzten Waldstück versteckt. Die Spieler bekommen einen Stift und ein Blatt Papier und haben nun Zeit, alle Gegenstände zu finden und aufzuschreiben. Z.B. Nr. 1 = Boxershorts, Nr.2 = Lippenstift usw. Nach etwa zwanzig Minuten, je nachdem wie viele Gegenstände versteckt sind, kommen alle zum Treffpunkt zurück und die Zettel werden eingesammelt. Während die Zettel ausgewertet werden, haben die Spieler Gelegenheit, Bonuspunkte zu sammeln, indem sie die versteckten Gegenstände einsammeln und zum Spielleiter bringen.
Hasenjagd
Ein Teil der Gruppe bekommt eine farbige Armbinde und trägt diese gut sichtbar am Arm. Nun verstecken sich diese verschiedenfarbigen Hasen in einem vorher abgesteckten Gebiet mit möglichst vielen Verstecken, z.B. in einem Waldstück. Während des Spiels dürfen die Hasen auch das Versteck wechseln. Der Rest der Gruppe muss nun alle Hasen einfangen, doch je nach Farbe des Hasen sind dafür evtl. mehrere Spieler nötig. Grüne Hasen können nur von jemandem eingefangen werden, der größer ist. Um einen blauen Hasen zu fangen, braucht man zwei Jäger und für einen roten Hasen sogar fünf. Diese Einfang-Regeln lassen sich natürlich individuell anpassen, hier sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt.
Das Schatzei
Die Gelände- oder Raumkarte zeigt den Weg zum Ostereischatz. Dabei werden besondere Merkmale des Geländes in die Karte eingezeichnet. Für die Suche kann eine bestimmte Zeit festgelegt werden, die es zu unterbieten gilt. Man kann aber auch in mehreren Gruppen gegeneinander spielen und von verschiedenen Geländepunkten aus starten.
Ostereiersuche
In einem abgegrenzten Waldstück mit vielen Versteckmöglichkeiten werden Osternester versteckt. In jedem Osternest liegen Schokoladeneier in den unterschiedlichen Mannschaftsfarben. Die Spieler werden je nach Gruppengröße in Paare oder größere Gruppen eingeteilt und bekommen eine Farbe zugeteilt. Welche Mannschaft schafft es am schnellsten, alle Nester zu finden und die eigenen Schokoeier rauszunehmen?
Fuchs und Osterhase
Gespielt wird in einem Gelände mit vielen Verstecken. Besonders gut geeignet ist ein dichtes Waldstück. Ein paar Gruppenmitglieder sind die Osterhasen. Ausgerüstet mit Schokoeiern bekommen sie fünf Minuten Vorsprung, um sich zu verstecken. Unterwegs legen sie eine Spur aus Schokoeiern und versuchen, mit falschen Fährten die Füchse von ihrem Versteck abzulenken.
Klopfer-Memory
Etwa ein Viertel der Gruppe versteckt sich im Gelände, möglichst in einem Waldstück. Vorher bekommt jeder ein Holzstück und einen Stapel Spielkarten. Nun streifen die Klopfer durch das Gelände und machen im Abstand von ein bis zwei Minuten durch Klopfgeräusche auf sich aufmerksam. Die restlichen Spieler versuchen, die Klopfer zu finden und ihnen ein Kärtchen abzunehmen. Ziel ist es, möglichst viele Karten einzusammeln. Paare aus dem Memoryspiel zählen dabei doppelt. Die Spieler oder Teams dürfen auch miteinander verhandeln und Karten tauschen, um Paare zu bilden.
Jagd auf die Osterhasen
Vor dem Spiel werden Bierdeckel mit dickem Textmarker beschriftet. Jeder Jäger bekommt einen Bierdeckel, beschriftet mit einem J, die Osterhasen bekommen jeweils 10–15 Bierdeckel, gekennzeichnet mit einem O. In einem begrenzten Waldstück müssen nun die Jäger versuchen die Osterhasen zu finden und abzuschlagen. Gelingt ihnen das, tauschen sie mit dem Osterhasen den Bierdeckel. Den neuen Bierdeckel mit einem O tauschen die Jäger wiederum beim Spielleiter gegen einen Jäger-Bierdeckel. Jeder Tausch wird vom Spielleiter notiert. Gewonnen hat derjenige, der am meisten Treffer erzielt hat.
Promi-Suche in Palm Beach
In Palm Beach, Florida, ist die Promidichte sehr hoch. Sicher fallen den Jugendlichen so manche Promis ein, die entweder in Florida leben, oder die sich dort öfters von den Paparazzi ablichten lassen. Damit es nicht zu schwierig wird, soll es allerdings nicht nur um die Palm Beach-Promis gehen, sondern um Promis allgemein. Im Normalfall gibt es nicht DEN Promi, auf den alle Jugendlichen gleichermaßen abfahren. Deshalb gilt die erste Aktion dem Herausfinden, wer bei wem angesagt ist. Je nach Größe der Jugendgruppe werden die Jugendlichen nun in zwei oder mehr Gruppen eingeteilt (ca. 6–8 Personen pro Gruppe) und die Promi-Namen gesammelt. Dazu stehen A3-Blätter und Marker zur Verfügung. Schon während der Sammelphase ergeben sich hier sicherlich Gespräche, wer welchen Promi auch gut findet oder wer sich bei einem anderen Prominamen nicht so ganz anschließen kann. Die genannten Namen sollen nun in einer passenden Größe auf das Blatt geschrieben werden. Wird z. B. Sido vorgeschlagen, aber alle anderen finden ihn nicht so toll, wird Sido eher klein in eine Ecke des Blattes geschrieben. Sollte Ariana Grande von allen die Zustimmung erhalten, wird ihr Name ziemlich groß in die Mitte geschrieben. Johnny Depp bekommt die Hälfte aller Stimmen? Dann auch groß den Namen aufschreiben, aber natürlich nicht so groß wie Ariana Grande. In diesem Stil sammeln sich die Namen und parallel wird schon ein Gespräch in Gang kommen über die unterschiedlichen Meinungen zu den Promis. Am Ende werden die Ergebnisse in der Gesamtgruppe angeschaut und verglichen. Es gibt hier keine Punkte, da es hier ja eher um Geschmack als um Leistung geht.
Aufbrezeln wie in Palm Beach
Man stelle sich nun vor, das Gerücht würde umgehen, einer der besagten Promis käme nach Palm Beach und wir wären in Palm Beach. Das Gerücht hat wohl einen hohen Wahrheitsgehalt und der Promi kommt mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit in einer Stunde ungefähr in der Stadt an. Natürlich will man a) an vorderster Front dabei sein und sich das nicht entgehen lassen, b) dem Promi irgendwie auch einen würdigen Empfang bereiten, und c) dabei nicht allzu schlecht aussehen.
Aufgabe: 5 Minuten stehen zur Verfügung, um sich ein wenig im Palm-Beach-Style aufzubrezeln. Dazu stehen Bürsten, Kämme, Haargel und Kajalstifte sowie einige diverse Tücher/Schals und Loops zur Verfügung, mehr ist im Moment nicht drin. Daraus sollte das Beste gemacht werden. Aber auch aus den Klamotten, die die Jugendlichen tragen, kann man vielleicht noch mehr herausholen, um das Ganze etwas hipper und Palm-Beach-mäßiger aussehen zu lassen. In den Kleingruppen wird aufgebrezelt, und eine Jury aus den Gruppenmitarbeitenden kann dann auch bewerten, welche Kleingruppe das Aufbrezeln am besten in der kurzen Zeit geschafft hat.
Würdiger Empfang
Nach dem Aufbrezeln bleibt nicht mehr viel Zeit bis zur Ankunft des Promis, und man muss sich ja auch noch rechtzeitig aufmachen, um gute Plätze zu ergattern. Aber so ein bisschen würdiger Empfang in Palm Beach sollte ja auch sein. 10 Minuten stehen zur Verfügung, um aus dem bereitgelegten Material oder allem, was irgendwie greifbar ist, eine willkommen heißende Atmosphäre in Palm Beach zu schaffen. Ob Banner oder Fähnchen, ob Flashmob oder Gedicht, ob Schlachtruf oder Lied – Phantasie ist ausdrücklich erwünscht! Auch hier wird wieder in den Kleingruppen gearbeitet, auch hier bewertet die Jury wieder die Ergebnisse.
Sich nichts entgehen lassen
Nun ist schon viel Zeit vergangen und es geht darum, so schnell wie möglich einen möglichst guten Platz zu ergattern. Jede Kleingruppe erhält 2 Minuten Besprechungszeit und soll überlegen, auf welchem Weg der Promi wohl in den Ort kommt und wo man sich dann am besten postiert. Sind die 2 Minuten abgelaufen, findet ein Wettrennen statt vom Startort bis zu einem Platz, den die Jury festgelegt hat. Die Gruppe, die nach dem Startpf ff zuerst vollständig am Zielort angekommen ist, erhält die Punkte der Jury. Am Zielort darf dann auch jede Gruppe verkünden, wo sie den besten Platz sieht, um sich für einen Promibesuch zu positionieren und dies dann auch begründen. Für die Idee und die Begründung gibt es noch mal Punkte von der Jury.
Impuls: Der Promi-Besuch
Nicht nur heute gibt es Menschen, die bekannt sind und die man faszinierend findet. Auch schon vor 2000 Jahren war das so. Und so, wie auch heute die einen Leute einen bestimmten Promi total cool finden, haben andere etwas an ihm zu kritisieren oder sind einfach nur mäßig begeistert, weil er sie nicht interessiert, seine Art oder Ausstrahlung sie nicht berührt, andere aber schon. So war es auch mit Jesus. Es gab Menschen, die waren total fasziniert von seiner Art. Es gab andere, die erzählten sich begeistert von den Wundern weiter und verehrten ihn. Es gab Menschen, die hörten sich das alles kritisch an, bewegten die Worte aber in ihrem Herzen. Andere standen ihm total ablehnend gegenüber. Vielleicht weil viele Pharisäer und Schriftgelehrten vor ihm warnten oder weil er ihnen einfach so suspekt war. Es gab auch Personen, die redeten einfach so wie das Fähnchen im Wind über ihn. Je nachdem, mit wem sie grade zusammenstanden, mal so und mal so. In diese Situation hinein kam Jesus nach Jerusalem. Unglaublich viele Menschen waren zum Passahfest nach Jerusalem gekommen. Wem es möglich war, der kam zum Zeitpunkt des Passahfestes nach Jerusalem. Zum Tempel. Weil sie sich hier gemeinsam an die wunderbare Hilfe Gottes beim Auszug aus der Sklaverei aus Ägypten erinnern wollten. Weil sie besonders jetzt, unter der verhassten römischen Herrschaft, wieder auf eine Befreiung hofften. Dass Gott wieder einen Retter schickt, wie damals Mose. Viele glaubten fest daran, dass Gott nicht nur einen Propheten schicken würde, sondern den in den alten Schriften verheißenen Messias. Wenn dieser Jesus wirklich der Messias, der Retter, war, dann müsste man ihn empfangen wie einen König, wie den Retter, der von der römischen Herrschaft befreite, der von Gott geschickt wurde, der zeigte, wie nahe ihnen Gott war.Aber es gab auch andere, die sich genau darüber ärgerten. Vor allem unter den Pharisäern und Schriftgelehrten gab es viele, die waren sich ganz sicher: Erst, wenn alle Juden die Gesetze Gottes halten, dann kommt der Messias. Vorher nicht. Deshalb bemühten sie sich ja auch so sehr, Gottes Gesetze einzuhalten. Und sie erfanden viele weitere Gesetze um Gottes Gebote herum, um besser sicherzustellen, dass man das endlich schafft. Und Sie hofften so sehr darauf, dass die Juden sich so abmühten Gottes Gesetze einzuhalten, wie sie selbst das überzeugt taten. Aber dieser Aufrührer Jesus, der brach Gottes Gesetze. Zum Beispiel das Sabbatgebot. Er hatte nicht nur einmal an einem Sabbat einen Men-schen geheilt, obwohl er doch bis zum nächsten Werktag hätte warten können. Dieser Jesus scherte sich scheinbar nicht um Gottes Gebote. Er behauptete sogar dreist, der Mensch wäre Gott wichtiger als die Gebote. Und er behauptete wohl sogar, er sei Gottes Sohn. Das war Gotteslästerung in ihren Augen. Nicht, weil sie böse waren, sondern weil sie verletzt waren für ihren Gott, verletzt in ihrem festen Glauben. Manche Menschen waren auch wegen des Passahfestes in Jerusalem, weil hier der Tempel stand. Weil sie daran glaubten, dass Gott hier im Tempel besonders nahe war. Manche wollten ihrer Unzufriedenheit mit ihrem Leben, mit der politischen Situation, mit der Unterdrückung durch die Römer Ausdruck verleihen. Sie hofften, hier in der Hauptstadt Gleichgesinnte zu finden, mit denen man sich zusammen-schließen konnte, gegen die Römer aufbegehren. Manche sahen auch in Jesus den Anführer so einer aufständischen Gruppe, weil sie sich aus tiefstem Herzen von Gott wünschten, dass er sie auf diese Art befreien sollte.
Viele Menschen waren also in Jerusalem. Es war nicht einfach nur eine einheitliche Masse, sondern jeder hatte andere Erlebnisse, andere Erwartungen, andere Hoffnungen. In diesen aufgeheizten Kessel voll unterschiedlichster Menschen kam nun Jesus. Er kam mit seinen Jüngern in einem Vorort von Jerusalem an und ließ die Jünger dann einen Esel holen. Die Jünger warfen Mäntel über den Rücken des Esels, und Jesus setzte sich auf ihn und ritt hinein nach Jerusalem. Ob der Esel brav war oder ab und zu mal bockte, wie Esel das eben tun, steht nicht in der Bibel. Ob es zügig vonstattenging oder sich über eine sehr lange Zeit dahinzog, steht auch nicht drin. Die biblische Geschichte vom Einzug nach Jerusalem ist relativ kurz beschrieben.
Eine jüdische Bibelauslegung sagt, dass dieser Text mit Wörtern aus der Schrift wie schwarzes Feuer ist, das lodert. Aber dazwischen lodert auch das sogenannte weiße Feuer. Alles das, was nicht geschrieben dasteht, was aber die Menschen gedacht und gefühlt haben. Was geht denn diesen ganzen Menschen durch den Kopf, die da zum Straßenrand geeilt sind, um Jesus zu sehen und zu begrüßen? Die vielen einzelnen Menschen, mit je individuellen Geschichten, Gefühlen, Erlebnissen, Hoffnungen, Erwartungen, Gedanken. Was denken diese Menschen, was rufen sie?
Aufgabe: Jeder bekommt zwei Gedankenblasen und zwei Sprechblasen zum Ausfüllen. Wer möchte, bekommt auch mehr. Die Teilnehmenden sollen sich in die Menschen damals hineinversetzen. In wen können sie sich gut hineinfühlen? In die, die aufbegehren und ihr Schicksal aktiv in die Hand nehmen wollen? In die, die spüren, dass dieser Jesus mehr ist als ein Wunderheiler? In die, die in Jesus einfach den spannenden Promi sehen? In die, die sich über ihn aufregen? Was denken die Menschen heimlich, nur für sich? Und was sagen sie laut? Manche sind mutig, manche sind ängstlich, manche fragend, manche hoffend, manche freudig, manche unsicher. Die Teilnehmenden füllen ihre Sprechblasen aus und legen sie links und rechts von einer „freien Bahn“, die wie eine Straße wirken kann. Jeder liest seine Gedanken- und Sprechblasen vor, eine nach der anderen und legt sie hin. Dies wird nicht kommentiert, nur die Fülle an Gedanken und Kommentaren der Menschen damals steht im Raum. Dann wird an den Anfang der Straße ein skizzierter Esel mit Jesus gelegt. Aus Papier oder als Egli-Figur oder als Kerze usw.
Der Bibeltext aus Matthäus 21,1–11 wird nun vorgelesen und die Teilnehmenden sehen dabei ihre Sprech- und Gedankenblasen und am Beginn der Straße den symbolischen Jesus. So war das damals. Und heute? Es wird nun nichts aufgeschrieben und nicht darüber geredet, weil dies sehr persönlich ist. Wo stehe ich denn heute? Wie sehe ich heute, 2000 Jahre später, Jesus? Als jemanden, dem man ein Mal in der Woche im Teenkreis begegnet? Oder als jemanden, der mein Leben verändert hat und weiter verändern will? Oder als einen, bei dem ich noch nicht so recht weiß, was ich von ihm halten soll? Vielleicht als einen, den ich nicht so ganz verstehe? Oder sehe ich ihn als jemanden, an den ich große Erwartungen habe? Was für einen Jesus sehe ich dastehen, am Anfang der Straße? Wenn ich da heute stehen würde und er da käme? – Zeit lassen zum Nachdenken
Viele bunte Papierstreifen aus verschiedenfarbigem Tonpapier liegen bereit. Blau, Grün, Rot, Gelb, Weiß, Orange, Violett, Braun, Grau, Schwarz. Jeder darf sich drei farbige Streifen in den Farben holen, die für ihn die persönlichen Gefühle symbolisieren. Da keiner weiß, was man selbst mit den Farben verbindet, kann keiner wissen, was für den Einzelnen hinter der Farbbedeutung steckt. Für den einen heißt Rot: Vorsicht, würde ich mich nicht darauf einlassen, für den andern bedeutet es: meine tiefe Liebe zu ihm. Deshalb einfach drei Farbstreifen holen, in verschiedenen oder auch gleichen Farben. Dann wird der Bibeltext vorgelesen, diesmal aus Lukas 19,28–40, und jeder legt in diese Gasse zwischen den Sprech- und Gedankenblasen von damals die „farbigen Gefühls-Teppiche“ von heute. Nun liegt da ein bunter Flickenteppich auf der Straße, so wie damals ein bunter Flickenteppich aus Überkleidern und Mänteln lag.
Zum Abschluss wird Jesu Einzug in Jerusalem nach Johannes 12,12–19 vorgelesen. Je nachdem wie gut die Gruppe sich kennt, kann man dies nun so stehenlassen oder noch in einen offenen Austausch gehen. Anschließend gibt es eine stille Zeit zur persönlichen Reflexion. Zeit zum Nachdenken über den Text oder für ein stilles Gespräch mit Gott bzw. mit dem Jesus, der damals vor 2000 Jahren am Palmsonntag nach Jerusalem kam.
Das Fest
Damals wurde gefeiert. Laut und mit Musik, Getränken, Essen. Deshalb soll es nun auch festliche Getränke à la Palm Beach geben. Zutaten für Cocktails stehen bereit, evtl. auch Rezepte für Cocktails. Es kann entschieden werden, ob dies nun auch im Wettbewerb gegeneinander geschieht oder gemeinsam. Aus Palmsonntag damals kann so Palm Beach-Feeling heute werden. Wenn die Cocktails fertig sind, kann man sie genießen, zusammensitzen und natürlich auch noch passende Lieder singen – vor allem die, in denen Jesus als König bezeichnet wird, passen hier besonders gut.